
Der Tod im Licht von Natur und Seele – Gedanken nicht nur zum Totensonntag

„Endlich!“ – so lautete die Inschrift auf dem Grabstein eines Menschen, der sich vor seiner Endlichkeit gefürchtet und nach Ewigkeit gesehnt hatte. (C. Loose)
Unaufhaltsam vollzieht sich der Wandel der Jahreszeiten, unumkehrbar der in Ruhe und Schlaf sich zurückziehende Wandel in der Natur des Herbstes. Reife, Duft, Klang und Fülle des Sommers gehen über in Zerfall, ins Absterben, in Verwesung und in Stille …
Wer aber kennt sie nicht, die Augenblicke des belebenden Aufschauens an einem sonnigen Tag beim Eintauchen in einen herbstlichen Park oder Wald? Kathedralengleich wölben sich die lichtdurchfluteten Baumkronen überm staunenden Auge. Die leuchtende Diaphanie des absterbenden oder schon gefallenen Blattwerks, die Silhouetten der hohen Säulen und des verzweigten Geästs und, unten am Erdboden, die raschelnden Tritte – dies alles sättigt unsere Sinne.
Den Wanderer trifft an diesen Tagen noch einmal ein Abschiedsblick des Sommers, auch wenn die Schatten länger und tiefer werden. Reife, ja überreife Früchte leuchten am Strauch oder liegen am Boden verstreut, und das geheime, unterirdische Flechtwerk der Pilze zieht nahe am Boden grüßend seine erdfarbenen Hüte, Kappen und Schirme. …Erregte Häherrufe oder das geschäftige Wispern der Meisen, wie in der Zeit irrlichternde Liebeslaute, durchdringen jäh die Stille. An der Stelle, wo Blatt oder Blüte abfiel, entdeckt das Auge schon die Knospenansätze, die die Wiederkehr des Lebens im kommenden Frühling verheißen.
Wie nahe verbunden sind doch in der Natur – dem großen Buch der Gleichnisse – Vergehen und Werden, Tod und Leben.
Im Herbst vermag das Vergehen und Absterben in der Natur sich in lichter, goldener Größe zu vollziehen. Richard Strauß in seiner Vertonung von Hesses „September“ oder Rilkes berühmtem Gedicht „Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß …“ haben diese erfüllte und auch wehmütige Abschiedsstimmung wunderbar tonmalerisch erfasst.
Wie unser Menschendasein mit diesen Wandlungen des Lebens und seinen Erscheinungsformen verbunden ist, empfinden wir in solchen Zeiten vielleicht stärker als eines der großen Rätsel, deren Antworten sich eher dem Denken des Herzens als dem Denken des Kopfes zu erschließen vermögen.
Wenn wir unser Dasein durchleben, wandeln auch wir als Teil der Natur unsere Erscheinungsform, unsere Umhüllungen und unsere Lebensräume innerhalb der jedem gegebenen Daseinspanne in Raum und Zeit. Langsamer verläuft dabei – im Vergleich zur Lebensuhr des körperlichen Alterungsprozesses – die Zeit unserer Seele, und unser Geist bildet die Achse, um die sich das Rad unserer Lebenswandlungen bewegt. Die größten Wandlungen im menschlichen Leben aber sind Geburt und Tod.
Für das Denken und Fühlen von Novalis (1772 – 1801) waren die Geburt des Menschen ebenso wie der Sterbeprozess, das Ablegen des Körpers mit dem Tode, Prozesse e i n e s übergeordneten, großen W e r d e n s:
„Wenn ein Geist stirbt, wird er Mensch. Wenn der Mensch stirbt, wird er Geist.“
Diesen Satz empfand ich immer als Schlüsselsatz, der ein erhellendes Licht auf Leben und Sterben, auf Geburt und den Tod als Lebenswandler wirft.
In der Atmosphäre eines Bestattungsunternehmens
Der seelische Boden, auf den dieser Novalis-Gedanke fiel, war vorbereitet durch meine Kindheits-und Jugenderlebnisse in meinem Elternhaus, in dem ich täglich die Atmosphäre eines Bestattungsunternehmens erlebte, das meine Mutter gemeinsam mit meiner Tante führte.
Nicht selten gingen die beruflichen Anforderungen auch über die regulären Geschäftszeiten hinaus. Mal war es ein abendlicher oder nächtlicher, mal ein feiertäglicher Anruf aus einem Privathaus, der einen Sterbefall und dessen vielfältige praktische Abwicklung einforderte und damit in unseren familiären Alltag hereinbrach. Vieles blieb dann stehen und liegen. Der Tod kennt keine Geschäftszeiten, keinen Feierabend, keine Nachtruhe und kein „An Sonn und Feiertagen geschlossen“.
So hieß es denn auch an einem Heiligen Abend, den Leichenwagen aus der Garage zu fahren, ein Tragetuch einpacken und einen leichten, einfachen Sarg zum Transport des Toten einladen, telefonisch einen Träger organisieren, um dann den Ort des plötzlichen Sterbefalls aufzusuchen, Treppen hinaufzusteigen, dabei schon abschätzend, wie man mit dem Verstorbenen im Tragetuch wieder hinunterkäme, in der Hoffnung, der Leichnam wäre nicht so schwer. Wo im Treppenhaus bzw. dem Eingangsbereich den offenen Sarg abstellen? Möglichst diskret in einem Mehrfamilienhaus oder in einer belebten Wohngegend, um den etwaigen Schreck der Unbeteiligten zu mildern?
Da war sie, die Todesfurcht, greifbar auch in mir selbst, dem Helfer im Bestattungsunternehmen: der Tod als Erschrecker, dessen Anblick man den Fernerstehenden ersparen wollte und musste.
Einen Verstorbenen aus seinem häuslichen Umfeld holen hieß immer, mit der Plötzlichkeit, dem Unerwarteten des Todes und des Sterbens konfrontiert zu sein. Und, ja, ging man denn nicht als Bestatter gleichsam eine Komplizenschaft mit dem Tod ein?
Der Tod als Erschrecker
Wenige Menschen trifft der Sterbefall eines nahen Angehörigen wirklich vorbereitet und zu wenigen kommt der Tod erwünscht, und so musste ein Verstorbener oft „so schnell wie möglich“ aus dem Hause geschafft werden. Vielfach wurde und wird der Tod immer noch, teils panisch, an den Rand des Lebens gedrängt, in die Keller der Krankenhäuser etwa. Doch hat sich im Bestattungswesen in den letzten fünfundzwanzig Jahren auch vieles zum Besseren gewandelt. Die anonymen Aufbahrungsräume, die tristen Leichenhallen und sterilen Zellen der Friedhöfe haben sich vielfach gewandelt in atmosphärisch wohltuend gestaltete Andachtsräume der Bestattungsunternehmen, die für Trauernde ein ungestörtes, persönliches Abschiednehmen vom Verstorbenen ermöglichen.
Wer einmal einen Toten gesehen hat, der kennt vielleicht das unheimliche Erlebnis, das Friedrich Hebbel (1813 – 1863) eindrucksvoll so beschreibt:
„Ein Toter wirkt auf den, der ihn sieht, wie der Tod selbst. Man glaubt, er könnte die Wimper heben und dann müsste der Pfeil herausfahren; man sieht hinter seinen geschlossenen Augen den Tod mit gespanntem Bogen.“
Lässt sich aus Hebbels Worten nicht noch die uralte Furcht vor dem Wiedergänger, dem „Untoten“ heraushören? Die Angst, das Entsetzen im Anblick des Verwesenden?
Den Angehörigen stand, wenn nicht untröstliches Entsetzen, dann doch der absolute Ernst der Todesbegegnung ins Gesicht geschrieben, wenn der bis vor wenigen Stunden noch Lebende, vom Arzt auf etwaige Lebenszeichen untersucht und nun aber unwiderruflich Dahingegangene, noch dort lag, wo ihn der Schlag getroffen, sein Herz den letzten Schlag getan oder eine Überdosis Schlaftabletten scheinbare Erlösung von Lebensqualen gebracht hatte.
Der, den ich in meiner Erinnerung vor mir sehe – ein bekannter Schriftsteller, der damals zurückgezogen in meiner heimatlichen Kleinstadt lebte – hatte den Freitod gesucht und lag nun auf dem Bett seines Schlafzimmers in fötal zusammengekrümmter Haltung, um ihn herum eine Aura der Friedlosigkeit und des dumpf und schwer Bedrückenden. Ein lähmender Nachhall von Kampf und Qual lag im Raum, der uns Umstehende mit leisem Grauem anwehte. In einer völlig abgewendeten, erstarrten Haltung lag der Tote auf seinem Bett, bevor wir ihn aufhoben. Ein fürchterlicher, plötzlicher Augenaufschlag war hier nicht mehr zu fürchten, denn er mochte schon vor vielen Stunden den Tod gefunden haben. Er fühlte sich, als wir ihn anhoben und ins Tragetuch betteten, bereits eiskalt an.
„Ich musste doch noch einmal zurück“
„Was ich dort fühlte und sah – nicht mit meinen gewöhnlichen Augen natürlich – als ich zu der Gestalt des Schiffers aufblickte, während ich am Boden des Kahns lag, den er übers Wasser fortbewegte, hat mir jede Angst vorm Sterben oder vorm ungewissen ‚Danach‘ genommen.“ Das erzählte mir vor Jahren die Mutter eines Freundes von ihrem Sterbeerlebnis, aus dem sie noch einmal zurück ins Leben kam.
„Es beunruhigte und beängstigte mich viel mehr, dass ich zurückkehren musste ins Reich der Lebenden, zu meinen Söhnen und Töchtern und deren Familien, die alle weit weg von mir lebten, und die nun um mein Sterbebett herum versammelt saßen. Während sie Gebete sprachen und ich von einer Lungenembolie geschüttelt dalag – von außen gesehen sicherlich ein schwer zu ertragender Todeskampf, war aber mein inneres Erleben ein ganz anderes: unbeschreiblich der Frieden und die Geborgenheit, die ich auf dem Boden des Kahns liegend empfand, während ich zum Fährmann aufschaute. Ich wünschte mir sehnlichst, bei ihm bleiben zu dürfen – und musste doch noch einmal zurück in mein ‚betreutes Wohnen‘ mit seiner alltäglichen beängstigenden Einsamkeit und Monotonie.“
Was sich auf dem Antlitz dieser alten Dame widerspiegelte, als ich viele Monate nach diesem Gespräch am offenen Sarg von ihr Abschied nahm, waren tiefer Frieden und Bejahung. Ein wissendes Lächeln spielte um ihre Mundwinkel, und die erst ein oder zwei Tage aus ihrem Körper herausgezogene Lebens- und Seelenkraft schien ihr erstaunlich verjüngtes Antlitz noch, wie ein diaphanes, höchst subtiles Licht- und Schattenspiel sanft zu umleuchten.
Wie oft sah ich auf dem Antlitz auch vieler anderer Gestorbener – manchmal nur für Stunden, manchmal auch noch nach Tagen – diese lichte, versöhnliche Seite des Todes, die mich jedes Mal ergriff, auch wenn ich – wie in den meisten Fällen – mit dem Verstorbenen nicht in besonderer Beziehung gestanden hatte.
„Licht, wie es mit der Finsternis die Farbe wirkt, ist ein schönes Symbol der Seele, welche mit der Materie den Körper bildend belebt. So wie der Purpurglanz der Abendröte schwindet und das Grau des Stoffes zurückbleibt, so ist das Sterben des Menschen. Es ist ein Entweichen, ein Erblassen des Seelenlichtes, das nur aus dem Stoffe weicht. Daher sehe ich keine Toten. Alle meine gestorbenen Freunde sind mir so verblichen und verschwunden …“ (Goethe an Riemer, 3.12.1808)
Und an dem Grab jener älteren Dame schien mir, während am tief blauen Mittagshimmel die Frühlingssonne die dahintreibenden Wolken durchleuchtete, als wären diese Kräfte, die die Verstorbene verlassen hatten und die im Leben in jedem Augenblick im physischen Körper dessen Zerfall, seiner Schwere und seiner Zersetzung entgegengewirkt hatten, nun in die Natur entlassen worden, befreit von der Aufgabe, die leibliche Gestalt kontinuierlich zu beleben und zu formen.
Der Musiker, Pädagoge und Autor Jürgen Motog lebt in Caputh – Schwielowsee in der Nähe von Potsdam und leitet dort das HAUS DER KLÄNGE.
Zum Thema: Der Tod als Lebenswandler – Gedanken nicht nur zum Totensonntag
Ein Friedhof, der Weite und Stille atmet








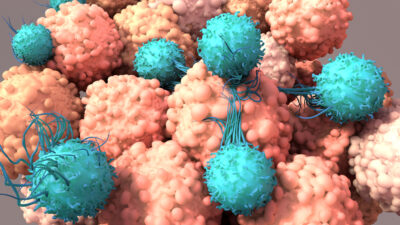





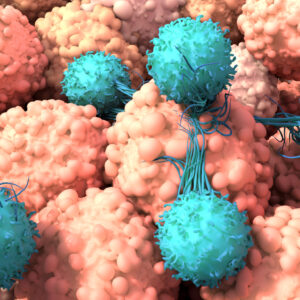














vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion