
Beate Zschäpe bekommt die in Deutschland mögliche Höchststrafe

Beate Zschäpe hat die in Deutschland mögliche Höchststrafe bekommen: Lebenslänglich, dazu die besondere Schwere der Schuld. Wie viele Jahre hinter Gittern daraus tatsächlich folgen, ist aber nicht absehbar.
Lebenslange Haft für immer sieht das deutsche Strafrecht nicht vor. Wegen einer Verletzung der Menschenwürde ist die Anordnung unbegrenzter Strafen verboten.
IM SCHNITT 20 JAHRE
Durchschnittlich läuft eine lebenslange Strafe auf etwa 20 Jahre Haft hinaus. Die Spanne ist allerdings groß: In seltenen Fällen kommen Verurteilte noch vor Ablauf von 15 Jahren frei, dies etwa im Fall von Begnadigungen. In anderen Fällen reicht die Haft doch bis ans Lebensende. Beispielhaft stehen dafür die Mörder Heinrich Pommerenke und Hans-Georg Neumann. Serienmörder Pommerenke verbrachte bis zu seinem Tod im Jahr 2008 rund 49 Jahre hinter Gittern. Eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung wurde ihm wegen des hohen Sicherheitsrisikos, das von ihm ausging, verwehrt. Der Doppelmörder Hans-Georg Neumann sitzt inzwischen sogar seit 56 Jahren, wiederholt wurden seine Anträge auf Aussetzung seiner Strafe wegen seiner Gefährlichkeit ausgesetzt.
BESONDERE SCHULDSCHWERE VERZÖGERT STRAFAUSSETZUNG
Stellt das Strafgericht wie bei einem Täter die besonders Schwere der Schuld fest, etwa weil ein Mord besonders grausam war oder sexuelle Neigungen eine Rolle spielten, ist eine Strafaussetzung zur Bewährung in der Regel frühestens nach 17 Jahren möglich. Das Gericht legt dann nach Ablauf der 15-Jahresfrist fest, wie viele Jahre seiner Strafe der Verurteilte noch wegen seiner Schuld verbüßen muss. Eine feste Obergrenze gibt es dabei nicht.
SICHERUNGSVERWAHRUNG WURDE NICHT VERHÄNGT
Eine Sicherungsverwahrung, wie es die Bundesanwaltschaft für Zschäpe gefordert hatte, ordnete das Münchner Gericht nicht an. Die Maßnahme wird verhängt, wenn die Gesellschaft wegen ihrer Gefährlichkeit auch nach der Haftverbüßung vor Tätern geschützt werden soll. Diese Täter müssen in Einrichtungen untergebracht werden, die sich deutlich von regulären Gefängnissen unterscheiden. Die Sicherungsverwahrung gilt im juristischen Sinn nicht als Strafe, da sie sich nicht auf begangene Straftaten bezieht, sondern mögliche neue Taten verhindern soll. (afp)




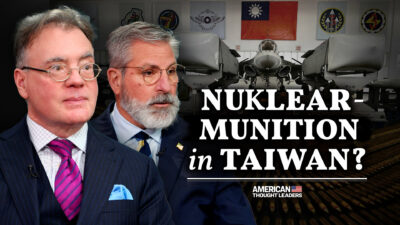






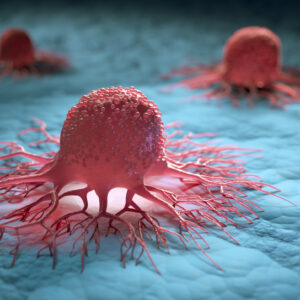

















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion