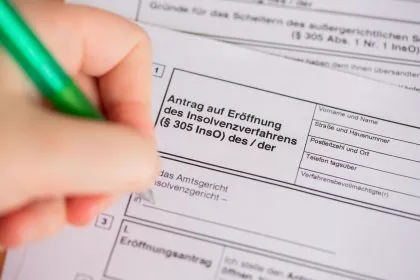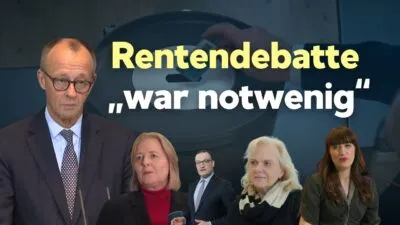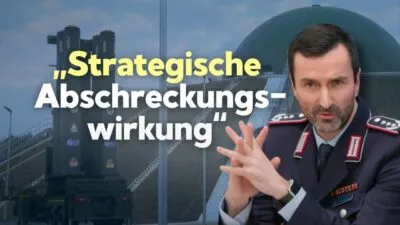Politische Aufarbeitung
Corona-Kommission kritisiert Maßnahmen in Sachsen-Anhalt: Landtag debattiert Konsequenzen
Nach der Vorlage des Abschlussberichts zur Corona-Politik in Sachsen-Anhalt fordern FDP und Linke Konsequenzen. Im Landtag wird deutlich: Die Pandemie offenbarte strukturelle Schwächen, vor allem in Kommunikation, Entscheidungsprozessen und im Umgang mit Grundrechten.

Im Landtag von Sachsen-Anhalt soll der Bericht der Regierungskommission zur Corona-Pandemie erörtert werden.
Foto: via dts Nachrichtenagentur
Knapp einen Monat nach der Vorlage des Abschlussberichts der Regierungskommission zur Corona-Politik in Sachsen-Anhalt wird dieser zum Thema im Landtag. Am Donnerstag, 14. Juni, haben sich die FDP und die Linksfraktion zu Wort gemeldet und Konsequenzen gefordert.
Die Fraktion der Liberalen, die seit 2021 mit CDU und SPD in einer sogenannten Deutschlandkoalition regieren, kritisierte die Kommunikation staatlicher Behörden. Ihr gesundheitspolitischer Sprecher Konstantin Pott verwies auf Vereine, die bei ihren Planungen klare Antworten vermisst hätten. Man habe Maßnahmen nicht nachvollziehbar begründet und Kritik nicht aufgenommen. Deshalb sei es nicht verwunderlich, „wenn die Zustimmung zu den Maßnahmen am Ende sinkt“.
Kommission zur Corona-Politik in Sachsen-Anhalt legte Bericht vor
Die Fraktionschefin der Linken, Eva von Angern, warf der Landesregierung vor, „durchregiert“ und „sämtliche Parlamente kaltgestellt“ zu haben. Es sei ein großer Fehler gewesen, diese bei der Festlegung von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nicht einzubeziehen.
In Sachsen-Anhalt sollte eine 16-köpfige Expertenkommission, die aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zusammengesetzt war, im Auftrag der Regierung die Corona-Maßnahmen aufarbeiten. Im Mai hat die Regierungskommission „Pandemievorsorge“ ihren Abschlussbericht vorgelegt.
Darin hatte sie den politisch Verantwortlichen zwar grundsätzlich attestiert, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben. So habe man jene Maßnahmen ergriffen, die im Lichte des jeweiligen Informationsstandes als angemessen und zielführend erschienen.
Missachtung der Rechte Sterbender als gravierendste Form der Übergriffigkeit
Allerdings griff die Kommission auch Kritik aus der Praxis und von Betroffenen auf und ließ diese in 75 Handlungsempfehlungen für den Fall des Auftretens einer vergleichbaren Situation einfließen. Viele Maßnahmen hätten Betroffene als widersprüchlich und praxisfern erlebt. Es sei deutlich geworden, dass die Entscheidungsträger für eine Herausforderung dieser Art nicht gerüstet gewesen seien.
Dringlicher Handlungsbedarf bestehe mit Blick auf einen effektiveren Datenaustausch, eine bessere Kommunikation und eine stärkere Einbeziehung der Bevölkerung. Als besonders kritisch nahm die Regierungskommission, welche Experten unter anderem aus Justiz, Bildungswesen, Verwaltung, Gesundheitsmanagement oder Kammern umfasste, die Situation in Pflegeheimen wahr.
So seien die Rechte Sterbender und ihrer Angehörigen während der Pandemie zu stark missachtet worden. Dies habe vor allem die Phase der strikten Kontaktverbote zu Beginn der Pandemie betroffen. Hier sei es zu massiven Übertretungen individueller Rechte und Freiheiten gekommen:
„Viele Bewohnerinnen und Bewohner dürften ihre letzten Wochen oder Monate auf ihrem Zimmer verbracht haben, in Isolation von Familie und Freunden.“
Dabei seien diese in besonderem Maße auf Kontaktpflege mit nahestehenden Menschen angewiesen gewesen. Künftig müsse bei der Grundrechtsabwägung eine stärkere Gewichtung zugunsten der Menschenwürde erfolgen.
Haseloff: Sachsen-Anhalt hatte die moderateste Corona-Politik
Ministerpräsident Reiner Haseloff hatte sich bereits zuvor zu der Problematik geäußert. Er rechtfertigte Restriktionen beim Zugang zu Pflegeeinrichtungen mit den hohen Sterbezahlen. Diese seien keine politischen Anordnungen gewesen, sondern von den Betreibern selbst festgelegt worden.
Haseloff verwies darauf, dass professionelle Sterbebegleitung jederzeit möglich gewesen sei. Allerdings hätten die personellen Kapazitäten der Träger nicht immer ausgereicht, um diese zu gewährleisten. Es sei „auch nachvollziehbar“ gewesen, dass die Betreiber die Möglichkeiten im Rahmen ihrer Spielräume eingeschränkt hätten. Man habe Bewohner und Personal damit schützen wollen. Sachsen-Anhalt sei grundsätzlich das Land gewesen, das am weitesten von restriktiven Bundesvorgaben abgewichen war.
Gegenüber dem MDR gab es dazu jedoch Widerspruch vonseiten der Träger. Die Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt in Wittenberg, Corinna Reinecke, erklärte, es sei „damals einiges schiefgelaufen“. Die Isolation der Bewohner sei ein Aspekt dabei gewesen. Der mentale Druck sei damals groß gewesen, und die Politik sei es nicht gewesen, die versucht hätte, die Rechte der Betroffenen zu schützen.
Pflegeheimbetreiber: Politik hat Verantwortung abgeschoben
Vielmehr hätte diese die Verantwortung auf die Träger abgeschoben. Es habe fast täglich neue Durchführungsbestimmungen für Besucher und Heimbewohner gegeben. Die Betreiber hätten häufig ein hohes Risiko zugunsten der Betroffenen auf sich genommen, so Reinecke:
„Wir haben es im Einzelfall auf die eigene Kappe genommen, dass Angehörige sich von sterbenskranken Heimbewohnern verabschieden konnten.“
Die Kommission kritisierte auch, dass es an vielen Stellen „an Konzepten, Ausstattung, Wissen und Standards“ gefehlt habe. Selbst Hygienekonzepte habe man vielfach erst erstellen müssen.
Zu Misstrauen hätten auch chaotische und nicht nachvollziehbare Regelungen geführt. Für Kinder hätten nachmittags im Hort andere Regeln gegolten als vormittags in den Grundschulen. Finanzielle Hilfen hätten die am stärksten Bedürftigen häufig nicht erreicht. Baumärkte wären teilweise anders behandelt worden als andere Einzelhandelsgeschäfte.
Verständlichere Vorgaben und mehr Transparenz gefordert
Zu den Handlungsempfehlungen, die sich im Bericht der Kommission finden, gehört unter anderem die verständlichere Formulierung von Vorgaben für Einwohner und Verwaltung. Es müsse transparent und nachvollziehbar herausgearbeitet werden, wer zu den vulnerablen Gruppen gehöre und welche Teile der Bevölkerung unbehelligt bleiben könnten.
Sitzungen, in denen Entscheidungen getroffen würden, seien zu protokollieren und öffentlich zugänglich zu machen. Wichtig wäre es auch, nicht erneut den unzutreffenden Eindruck zu erwecken, die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) sei ein Entscheidungsorgan, das verbindliche Anordnungen treffen könne. Stattdessen seien Entscheidungen besser an die zuständige Ebene zu kommunizieren.
Reinhard Werner schreibt für Epoch Times zu Wirtschaft, gesellschaftlichen Dynamiken und geopolitischen Fragen. Schwerpunkte liegen dabei auf internationalen Beziehungen, Migration und den ökonomischen Folgen politischer Entscheidungen.
Aktuelle Artikel des Autors
7. Dezember 2025
Tübingen: Geburtstagsgruß ruft Datenschützer auf den Plan
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.