
Kommt eine Bereinigung an den Aktien- und Immobilienmärkten?

Angesichts der derzeitigen Aktien- und Bankenturbulenzen kann man die Frage stellen, ob außer den Bondmärkten auch die Aktien- und Immobilienmärkte überbewertet sind und daher eine Bereinigung an den Kapitalmärkten ansteht. Der Fokus wird auf Entwicklungen in den USA gelegt, da dort die größten weltweit tonangebenden Kapitalmärkte existieren.
Sind Aktien überbewertet?
Es soll im Folgenden zunächst kurz auf den S&P 500 eingegangen werden, den wohl weltweit wichtigsten Aktienindex. Allein die beiden im S&P 500 gelisteten Unternehmen Apple (2.457 Milliarden US-Dollar) oder Microsoft (2.043 Milliarden Dollar) kosteten Mitte März jeweils mehr als alle 40 DAX-Unternehmen zusammen (gemeinsame Marktkapitalisierung von etwa 1.500 Milliarden Euro).
Aus US-Sicht handelt es sich beim DAX also eher um „Peanuts“. Wenn der Aktienkurs von Apple um 10 Prozent steigt, entspricht das ungefähr einer Wertsteigerung des DAX um 16 Prozent. Kurz: Allein Apple oder Microsoft sind von der Börsenkapitalisierung her wichtiger als alle DAX-Unternehmen zusammen.
Das zeigt recht anschaulich die realen Markt- und Kapitalmachtverhältnisse zwischen den beiden Ländern.
Ein guter Indikator dafür, ob eine Überbewertung vorliegt oder nicht, ist das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), oder Englisch: Price-Earnings-Ratio (PE). Im Zähler steht der momentane Aktienkurs, im Nenner die Gewinne der letzten 12 Monate. Die Kennzahl beantwortet die Frage: Wie viele Jahre lang müsste das Unternehmen den derzeitigen Gewinn pro Aktie erwirtschaften, damit der heute bezahlte Aktienpreis wieder hereingeholt wird?
Das PE des S&P 500 liegt derzeit bei 21. Der Durchschnittswert der letzten 150 Jahre lag bei 16, der Median bei etwa 15. Gemessen an Median und Durchschnitt ist der S&P 500 also derzeit um etwa ein Drittel teurer als in der Vergangenheit. Anders ausgedrückt: Man muss heute, um sich einen Dollar Gewinn zu sichern, ein Drittel mehr für US-Aktien bezahlen als in den letzten 150 Jahren.
Die Aktienkurse sind also derzeit mit knapp einem Drittel weniger Gewinnen unterlegt als in der Vergangenheit. Das sieht zwar nach einer Überbewertung aus, wirkt aber nicht besonders dramatisch. Ein PE von 21 gab es in der US-Börsengeschichte schon oft, vor allem in den letzten 20 Jahren war das eher die Regel als die Ausnahme, ohne dass gleich ein Crash passiert wäre.
Kurz: Um wieder den historischen Durchschnittswert zu erreichen, müssten die Aktien demnach um etwa 25 Prozent sinken.
Der Shiller-PE ist heikel
Anders sieht es aus, wenn man das sogenannte Shiller-PE verwendet. Dafür nimmt man im Zähler wieder den aktuellen Aktienkurs, im Nenner aber die (inflationsbereinigten) durchschnittlichen Gewinne der letzten 10 Jahre. Das macht man, um kürzerfristige (Konjunktur-)Schwankungen der Gewinne zu bereinigen, um über das ständige konjunkturelle Auf und Ab hinauszuschauen.
Das Shiller-PE beträgt derzeit 28, ist also deutlich höher als das normale PE von 21. Während der letzten 150 Jahre belief sich das Shiller-PE im Durchschnitt auf 17, der Median lag bei etwa 16. Gemessen an den Werten der Geschichte sind demnach also die Aktien des S&P 500 derzeit 65 bis 75 Prozent teurer als in der Vergangenheit.
Um wieder auf den historischen Mittelwert zu kommen, müsste der S&P 500 um etwa 40 Prozent nachgeben. Das ist eine ganze Menge. Zum Vergleich: Am Vorabend der Großen Depression, im Oktober 1929, betrug das Shiller-PE 30, war also ähnlich hoch wie heute. Danach kam das Börsendesaster und die Große Depression.
Hohe Unternehmensgewinne mit der Lockdownpolitik
Welcher Indikator hat recht? Welcher ist aussagefähiger? Das PE oder das Shiller-PE? Vermutlich das Shiller-PE.
Die Unternehmensgewinne (nach Steuern) in den USA sind von 1.985 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2019 auf 2.891 Milliarden im dritten Quartal 2022 gestiegen, also um 45 Prozent. Das ist ein enorm starker Anstieg. Die Unternehmensgewinne haben im Zuge der Lockdownpolitik geradezu einen Jubelsprung gemacht. Die Gewinnquote erhöhte sich in diesen drei Jahren von 9,22 auf 11,24 Prozent vom BIP.
Das heißt, Ende 2022 flossen von 100 Dollar US-Sozialprodukt 11,24 Dollar an die Unternehmenseigentümer. Zum Vergleich: Anfang 2000 belief sich die Gewinnquote noch auf 5,27 Prozent.
In den letzten 22 Jahren hat sich also der Anteil der Wirtschaftsleistung, der an die Unternehmenseigentümer fließt, mehr als verdoppelt. Der andere Teil der Gesellschaft, vor allem die arbeitenden Menschen in den USA, bekommen heute sechs Prozentpunkte vom BIP weniger ab als vor 22 Jahren.
Vermutlich dürfte eine derart hohe Gewinnquote – ganz selten in der Nachkriegszeit war die Gewinnquote ähnlich hoch – auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten sein. Wenn die Gewinnquote sich wieder normalisiert, sprich sinkt, müssen auch die Aktienkurse mitsinken. Also ist vermutlich das Shiller-PE ein besserer Indikator als das normale PE. Das deutet auf ein beträchtliches Kursrückgangspotenzial beim S&P 500 hin.
Wie lange muss man arbeiten, um sich ein Haus leisten zu können?
Um zu beurteilen, ob die Immobilienpreise für Wohnimmobilien fair bewertet sind, nimmt man häufig das Verhältnis der Hauspreise zu den Einkommen. Je niedriger die Hauspreise im Verhältnis zu den Einkommen sind, desto erschwinglicher sind die eigenen vier Wände. In den USA betrug das Verhältnis der Hauspreise zum Medianeinkommen Anfang Dezember 2022 7,55.
Mit anderen Worten: Ein Median-Haushalt, also ein Haushalt mit exakt dem mittleren Einkommen (50 Prozent verdienen mehr, 50 Prozent verdienen weniger als der Medianhaushalt) müsste 7,5 Jahre arbeiten, um sich ein Haus leisten zu können. Das ist einer der höchsten Werte der Nachkriegszeit. Lediglich von April bis November 2022 war die Kennziffer ein wenig höher, in der Spitze im Juni 2022, betrug sie 7,74.
Zum Vergleich: Der höchste Punkt im Zuge der Immobilienkrise 2007–2009 lag bei 7,0 im Dezember 2007. Das war zu hoch und führte zur Immobilienkrise.
Von 1960 bis 2000 lag die Kennziffer praktisch immer zwischen 4 und 5, das heißt, die Familien mussten 4 bis 5 Jahre arbeiten, um sich ein Haus leisten zu können. Faktor 7,5 heißt, dass ein Medianhaushalt heute etwa 60 Prozent mehr arbeiten muss für ein Haus als in diesen 40 Jahren.
Heute sind die US-Immobilien für den Medianhaushalt also deutlich weniger erschwinglich als über weite Strecken der Nachkriegszeit und sogar teurer als zum Höhepunkt der Immobilienkrise vor 15 Jahren. Das klingt nicht gut und dürfte zu einem Preisrückgang bei Immobilien führen, weil sie deutlich überbewertet sind.
Das heißt nicht, dass eine Immobilienkrise wie 2007–2009 wiederkommt. Aber von Seiten des Immobilienmarktes wird in den nächsten Monaten keine Unterstützung für die Konjunktur kommen. Die Preise von Immobilienportfolios dürften deutlich sinken. Das gilt auch für Gewerbeimmobilien. Dort ist der Bereinigungsbedarf vermutlich sogar noch deutlich stärker als bei Wohngebäuden.
Ist es besser, etwas zu mieten als ein Haus zu kaufen?
Am Rande sei bemerkt, dass auch in Großbritannien die Hauspreise derzeit so teuer wie praktisch noch nie in der Nachkriegszeit sind. Das Verhältnis von Hauspreisen zu Durchschnittseinkommen liegt dort zurzeit bei 9. Von 1955 bis 2000 lag es meistens zwischen 4 und 5.
Immobilien in Großbritannien sind heute also fast doppelt so teuer wie von 1955 bis 2000 beziehungsweise halb so erschwinglich wie damals. Auch in vielen anderen Ländern hat sich der Index in den letzten Jahren deutlich verschlechtert, das heißt, die Häuser sind weniger erschwinglich geworden.
Ein anderer Indikator ist das Verhältnis von Hauspreis zu Mieten, der price-to-rent-ratio. Er gibt an, wie stark die Wohnungspreise durch Mieten unterlegt oder unterlegbar sind. Je höher die Hauspreise im Verhältnis zu den Mieten sind, desto stärker sind die Hauspreise den Mieten davongeeilt, und umso wahrscheinlicher liegt daher eine Überbewertung der Hauspreise vor.
In den USA ist dieser Index derzeit mit 136 so hoch wie fast noch nie in den letzten 50 Jahren. Kurz vor der Immobilienkrise 2007 lag er bei etwa 130. Das war zu hoch und es kam zum Immobiliencrash. Im Durchschnitt der letzten 50 Jahre lag er bei 100. Der price-to rent-ratio der USA von 136 weist also auf deutlichen Korrekturbedarf bei den Immobilienpreisen hin. Auch in vielen anderen Ländern liegt der Index momentan deutlich über 100.
Am Rande sei bemerkt, dass in Deutschland der Index momentan bei etwa 150 und damit so hoch ist wie fast noch nie. 2010 betrug er circa 90. Nur einmal in der jüngeren Geschichte war er für sehr kurze Zeit ähnlich hoch wie heute: Um 1982 lag er einmal kurz bei 160.
Auch in Deutschland sind also die Immobilienpreise den Mieten weit davongeeilt. Entweder werden die Mieten stark anziehen oder die Hauspreise sinken oder eine Kombination aus beidem.
Gewinne steigen schneller als das durchschnittliche Einkommen
Die Gewinne in den USA steigen seit mehreren Jahrzehnten stärker als die Wirtschaftskraft und deutlich stärker als die Medianeinkommen. Es findet also eine Umverteilung zugunsten der Unternehmenseigentümer statt. Das bedeutet eine starke Umverteilung von unten nach oben, weil die Unternehmen überwiegend den obersten ein Prozent der Bevölkerung gehören.
Auch die Hauspreise steigen seit Langem stärker als die Wirtschaftskraft und deutlich stärker also die Masseneinkommen. Auch das bedeutet eine Umverteilung zugunsten der Immobilieneigentümer und damit eine Umverteilung von unten nach oben.
Die Haushalte, Unternehmen und die Regierung der USA hatten Ende Dezember 2022 Schulden in Höhe von etwa 69.000 Milliarden Dollar, das entspricht etwa 264 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. In den letzten 15 Monaten sind die Zinsen in den USA (und weltweit) deutlich angestiegen, über alle Laufzeiten hinweg betrug der Anstieg etwa drei Prozentpunkte. Das bedeutet einen Anstieg der künftigen Zinszahlungen von etwa 2.000 Milliarden Dollar pro Jahr.
Wer zahlt die Zinsen letztlich? Die Zinsen auf die Staatsschulden werden von den Steuerzahlern bezahlt. Die Zinsen der privaten Haushalte werden von den privaten Haushalten bezahlt. Und der Zinsaufwand für Unternehmensschulden wird auf den Produktpreis aufgeschlagen und ebenfalls von den privaten Haushalten bezahlt.
Letztlich zahlen die Zinsen also praktisch alle Menschen im Land, Arm und Reich. Die Zinseinnahmen fließen jedoch zum größten Teil an die vermögenden Privathaushalte. Also auch durch den starken Zinsanstieg der letzten 15 Monate findet eine stark zunehmende Umverteilung von unten nach oben statt.
Die Lage ähnelt den „Roaring Twenties“
Momentan ist die Vermögenskonzentration in den USA so hoch wie noch nie in der Geschichte. Die oberen 0,01 Prozent der Bevölkerung besitzen derzeit etwa 10 Prozent aller Vermögen. Also ein Zehntel aller Gewinne, Mieten, Pachten und Zinsen fließen an die obersten 0,01 Prozent der Haushalte und beschleunigt dadurch die Vermögenskonzentration.
Dieses Geld fehlt beim Massenkonsum. Denn des einen Freud‘, des andern Leid: In den USA leben 44 Millionen Haushalte zur Miete. Davon zahlen 40 Prozent, das entspricht etwa 17,5 Millionen Haushalten über 35 Prozent ihres Einkommens für Miete. Da bleibt für den Konsum nicht mehr viel übrig.
All diese Entwicklungen, insbesondere die historisch hohe Gewinnquote, deuten darauf hin, dass die US-Ökonomie, ähnlich wie in den „Roaring Twenties“ in den 1920er-Jahren, in eine Überproduktions- beziehungsweise Unterkonsumtionskrise steuert. Das zeigen auch andere Zahlen. Seit Mitte der 1970er-Jahre steigt die Ungleichverteilung in den USA.
Die Medianeinkommen und damit die Massennachfrage bleiben seit Jahrzehnten hinter dem Wirtschaftswachstum zurück. Die Differenz wurde in den letzten 40 Jahren, in denen praktisch ununterbrochen die Zinsen sanken, mit immer mehr Schulden überbrückt, um die Massennachfrage am Laufen zu halten.
Das geht so lange gut, solange die Zinsen ständig sinken. Die Zeiten sind nun offenbar vorbei. Der starke Zinsanstieg seit gut einem Jahr wirft das Modell der letzten 40 Jahre, die zunehmende Nachfragelücke mit immer mehr Schulden zu decken, über den Haufen.
Das vernünftigste wäre ein Schuldenschnitt
Das Wachstumsmodell der letzten 40 Jahre, die zunehmende Ungleichverteilung über immer mehr Schulden zu überbrücken, funktioniert nicht mehr. Diese Strategie hat zu überhöhten Aktienkursen, zu hohen Immobilienpreisen und Rekordschulden geführt. All dies steht nun vor einer Bereinigung. Die Frage ist: Wie wird die Bereinigung stattfinden?
Die vernünftigste Lösung wäre ein Schuldenschnitt von 10 bis 30 Prozent, wie er beispielsweise 2011 von der konservativen Consultinggesellschaft BCG vorgeschlagen wurde. Das dürfte aber ebenso wie in der Vergangenheit auch jetzt nicht kommen, da sich die oberen ein Prozent über massive Lobbyarbeit dagegen wehren.
Kommt kein Schuldenschnitt, was wegen der Widerstände der Geldeliten sehr wahrscheinlich ist, so könnten die Schulden über Inflation reduziert werden. Auch das erscheint vor dem Hintergrund der jüngsten Maßnahmen der US-FED und anderer westlicher Notenbanken unwahrscheinlich.
Daher dürfte entweder eine starke Bereinigung an den Kapitalmärkten kommen, sprich Bank- und Börsenturbulenzen, vielleicht ein Börsen-Crash und eine anschließende starke Wirtschaftsbereinigung, möglicherweise ähnlich wie 1929 – 1932 – der „Großen Depression“ nach dem „Schwarzen Freitag“ an der New Yorker Wall Street am 24. Oktober 1929. Damals brach die Weltwirtschaft zusammen. Oder Krieg.
Zum Autor:
Prof. Dr. Christian Kreiß (geb. 1962), Promotion in Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte an der LMU München. Neun Jahre Berufstätigkeit als Bankier, davon sieben Jahre als Investmentbanker. Seit 2002 Professor an der Hochschule Aalen für Finanzierung und Volkswirtschaftslehre. Er ist Autor von sieben Büchern. www.menschengerechtewirtschaft.de







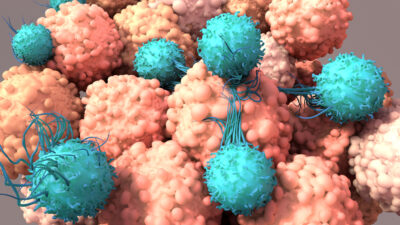




















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion