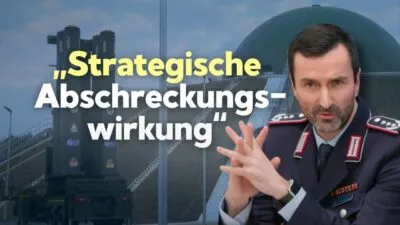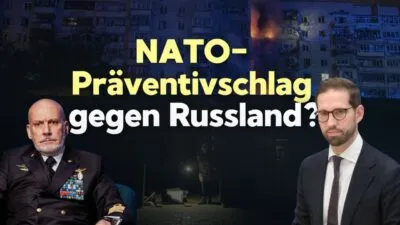Mit Peter Brabeck-Letmathe kehrt ein alter Bekannter ins Rampenlicht zurück. In sozialen Netzwerken wird diese Personalie kontrovers diskutiert – der Manager ist längst zur Symbolfigur für die engen Verflechtungen von Wirtschaft und globaler Politik geworden. Sein Wirken ist ebenfalls eng mit einer Ressource des Planeten verbunden: dem Wasser.
1944 im österreichischen Villach geboren, begann Brabeck-Letmathe nach seinem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 1968 bei Nestlé, damals zunächst in der Marketingabteilung in Chile. Innerhalb weniger Jahrzehnte arbeitete er sich bis in die oberste Etage des Konzerns vor.
1997 wurde er CEO der Nestlé S.A., eines der weltweit größten Unternehmen. Seine Amtszeit prägten Expansionsstrategien: Nestlé wuchs in neue Märkte und baute das Geschäft in den Bereichen Wasser, Babynahrung und Tiernahrung konsequent aus. 2005 wechselte der Manager in den Verwaltungsrat und blieb bis 2017 als Präsident eine prägende Figur des Konzerns.
Wasser als Lebensmittel: Öffentliches oder zu bezahlendes Gut?
Der vielleicht folgenreichste Moment in Brabeck-Lethmathes öffentlicher Wahrnehmung stammt aus dem Jahr 2005. In dem Dokumentarfilm „We Feed the World“ bezeichnete er als Chef des weltweit größten Abfüllers von Trinkwasser es als Extremhaltung, dass man als Mensch ein Recht auf Zugang zu Wasser habe.
(Ausschnitt hier anzusehen auf YouTube) Seine eigene Haltung machte er folgendermaßen klar:
„Wasser ist ein Lebensmittel. So wie jedes andere Lebensmittel sollte es daher einen Marktwert haben.“
Diese Aussage schlug Wellen. Für viele NGOs, Umweltaktivisten und Bürgerrechtler klang sie wie ein Angriff auf die Forderung, dass der Zugang zu Wasser ein universelles Menschenrecht sei. Proteste formierten sich weltweit. Brabeck-Letmathe selbst
präzisierte später seine Position: Natürlich müsse jedem Menschen ein Mindestbedarf an Wasser kostenlos zur Verfügung stehen. Doch sobald Wasser als industrieller oder kommerzieller Rohstoff genutzt werde – etwa für die Landwirtschaft oder die Industrie – sei ein fairer Marktpreis notwendig, um eine nachhaltige Nutzung sicherzustellen.
Ungeachtet seiner späteren Klarstellungen blieb der Vorwurf im Raum, wirtschaftliche Interessen über soziale Belange zu stellen. Die Debatte um Wasser als Menschenrecht, als öffentliches Gut oder als Handelsware gewann seither weltweit an Schärfe – nicht zuletzt
wegen Unternehmen wie Nestlé, die Leitungswasser oder mit
illegalen Methoden desinfiziertes Wasser als Konsumgüter vermarkten.
Kritik an Nestlés Wasserpolitik
Nestlé Waters, die Wassersparte des Konzerns, sorgte weltweit immer wieder für Schlagzeilen:
- Äthiopien: „Wasserabbau trotz Dürre“
- Kanada: dubiosen Geschäftspraktiken, da das Unternehmen trotz Wasserknappheit große Mengen Grundwasser entnimmt und verkauft.
- Brasilien: hier hat der Nestlé-Konzern durch die Privatisierung den Wasserpark São Lourenço gekauft und die Magnesiumquelle zur Austrocknung gebracht.
- Kalifornien: 2015 kam zutage, dass Nestlé das Trinkwasser im Nationalpark San Bernardino während 27 Jahren ohne Lizenz in Flaschen abgefüllt und verkauft hatte. Proteste der Bevölkerung folgten.
- Pakistan: hier pumpten Nestlé-Tochterfirmen Grundwasser, um es als Mineralwasser zu verkaufen. Dies geschah teils in Gegenden, in denen die lokale Bevölkerung bereits unter Trinkwassermangel litt.
Die Praktiken des Konzerns wurden unter anderem in der 2012
erschienenen Dokumentation „Bottled Life“ aufgezeigt. Der Konzern selbst schreibt auf seiner
Website zu seiner Präsenz in Pakistan und der Kritik an seinen Methoden, dass die Partner vor Ort Nestlé „in einem ganz anderen Licht“ sehen würden. Nämlich „als Vorreiter, der seine Verantwortung für Wasser auch über die
Werkstore hinaus vorbildlich wahrnimmt“. Für sein Engagement bekam Nestlé Pakistan von der UNO sogar einen
Nachhaltigkeitspreis verliehen.
Auf der Website des Konzerns heißt es weiter: „Allerdings ist der Einfluss des Werks auf die Wassersituation in Pakistan begrenzt – auf alle drei Werke von Nestlé in Pakistan zusammen entfallen nur 0,001 Prozent der gesamten Frischwasserentnahmen in Pakistan. Der größte Hebel für eine Verbesserung der Situation liegt in den landwirtschaftlichen Lieferketten. Daher engagiert sich Nestlé gemeinsam mit Partnern auch dafür, den Wassereinsatz in der Landwirtschaft zu reduzieren.“
Palmöl für Nestlé: großflächig Regenwald gerodet?
Nicht nur beim Wasser, auch beim Thema Umweltschutz sah sich Nestlé wiederholt öffentlicher Kritik ausgesetzt. Insbesondere die Verwendung von Palmöl führte zu Protesten: Organisationen wie Greenpeace warfen Nestlé vor, Zulieferer zu unterstützen, die für Plantagen großflächig Regenwald rodeten – mit dramatischen Folgen für Biodiversität und Klima. Konkret: Durch die Produktion von palmölhaltigen Schokoriegeln wie Kitkat trage der Konzern zur Zerstörung des indonesischen Urwalds bei.
Nestlé versprach 2010, in zehn Jahren nur noch Palmöl ohne Abholzung zu verwenden. Ebenfalls trat der Konzern dem
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) bei. Dennoch bleiben laut der Website
„Regenwald.org“ Zweifel an der tatsächlichen Umsetzung des Vorsatzes von Nestlé. Stand 2020: „Bis heute kann der Lebensmittelkonzern Regenwaldrodung für fast ein Drittel des Palmöls nicht ausschließen.“
Im Februar 2024 berichtete die Nachrichtenagentur
„Reuters“, dass ein Palmöllieferant, der unter anderem Nestlé beliefert, in einem der am besten erhaltenen Gebiete des peruanischen Amazonas Regenwald gerodet hat. Dabei wurden in der peruanischen Region Ucayali mehr als 130 Quadratkilometer abgeholzt, wobei der Großteil der Zerstörung seit 2012 stattfand, so die gemeinnützige Environmental Investigation Agency (EIA) in ihrem Bericht. Das ist eine Fläche, die mehr als doppelt so groß ist wie Manhattan.
Wirtschaftsliberaler Netzwerker
Peter Brabeck-Letmathe vertrat in zahlreichen Reden und Interviews die Auffassung, dass marktwirtschaftliche Prinzipien langfristig sowohl Wohlstand als auch sozialen Ausgleich schaffen könnten.
Seine Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum reichen weit zurück. Schon 2005 schrieb die Schweizer
„Handelszeitung“ unter dem Titel „Die Mächtigsten: Die Strippenzieher“, dass die Kritik am Lebenswerk von WEF-Gründer Schwab praktisch verebbt sei, seit das „WEF Diskussionsplattformen bietet, auf denen Globalisierungsgegner mit Novartis-Chef Daniel Vasella oder Nestlé-Lenker Peter Brabeck-Letmathe zum streitbaren Dialog schreiten können“.
Im WEF leitete er das „Water ressources“-Projekt. Im
Global Risks Report des Weltwirtschaftsforums von 2018 wird die Wasserkrise als eine der größten globalen Gefahren, der wir ausgesetzt sind, bezeichnet.
Dass gerade Brabeck-Letmathe nun vorübergehend an
die Spitze des WEF tritt, scheint folgerichtig. Seine Ernennung zum Interimsvorsitzenden des Weltwirtschaftsforums hat in jedem Fall Symbolcharakter.
Der 80-Jährige steht für die klassische Globalisierungsidee, die das WEF prägte. Er folgt auf den
87-jährigen WEF-Gründer Klaus Schwab, der
21. April 2025 mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Vorsitzender des Stiftungsrats zurückgetreten war. Dieser Schritt erfolgte vor dem Hintergrund schwerwiegender Vorwürfe, die durch einen anonymen Whistleblower-Brief an den WEF-Stiftungsrat erhoben wurden. Es geht um finanzielle und ethische Verfehlungen, die Schwab und seine Frau Hilde betreffen. Auch sein Sohn Oliver, der das China-Geschäft für das WEF aufgebaut hatte, hat mittlerweile die Organisation verlassen. Schwab Senior hat jüngst eine Strafanzeige wegen Rufschädigung gestellt gegen den unbekannten Verfasser des anonymen Schreibens.
Damit ist der WEF-Krimi aber noch nicht zu Ende, denn der geschasste WEF-Gründer plant laut
„SonntagsZeitung“ an der nächsten virtuellen Sitzung des WEF-Vorstands teilzunehmen. Diese war für den 13. Mai angesetzt. Dort wollte Schwab seinen Standpunkt zu den Vorwürfen mitteilen und einen Kompromissvorschlag unterbreiten.
Dieser beinhaltet, dass Schwab Ehrenpräsident des WEF wird, im Gegenzug will er die Ergebnisse der gegen ihn eingeleiteten Untersuchung akzeptieren und auch veröffentlichen. Wenn dieser Deal klappt, würde Schwab auf rechtliche Schritte gegen die Organisation verzichten. Wenn Schwab den Titel eines Ehrenpräsidenten bekäme, würde Peter Brabeck-Letmathe Interimspräsident bleiben.
Die operative Leitung des WEF liegt bereits seit 2017 bei Børge Brende, dem ehemaligen norwegischen Außenminister. Brende wird als möglicher Nachfolger Schwabs gehandelt, jedoch wurde bisher keine endgültige Entscheidung bekannt gegeben.