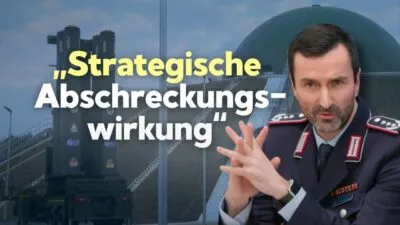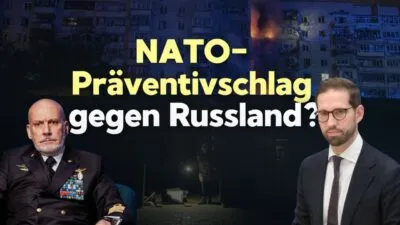Anwältin: „Corona hat zu Krise des Rechtsstaats geführt“ - Exekutive ohne Kontrolle
Die Mainzer Anwältin Jessica Hamed, die sich schwerpunktmäßig mit Rechtsmitteln gegen Corona-Maßnahmen befasst, hat eine „Krise des Rechtsstaats“ in Deutschland diagnostiziert. Parlament und Gerichte hätten sich zugunsten der Exekutive aus der Verantwortung gestohlen.

Justitia-Statue.
Foto: istock
In einem Interview mit der „Frankfurter Rundschau“ hat die Mainzer Rechtsanwältin und Dozentin Jessica Hamed scharfe Kritik an den Entwicklungen im Zuge der Corona-Krise geübt.
Sie sieht zum einen eine Exekutive, deren Handeln „meilenweit vom evidenzbasierten Handeln entfernt“ sei, zum anderen aber auch eine „Krise des Rechtsstaats“, in der sich nicht nur die Legislative, sondern auch die Judikative von ihrer Verantwortung entfernt hätten.
Gerichte arbeiten in Corona-Fällen nach dem Fließbandprinzip
Hamed, die bundesweit Mandanten in Verfahren wegen Übertretungen von Corona-Regeln vertritt und ihre Schriftsätze online publiziert, bemängelt, dass sich die Parlamente schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt selbst aus dem Spiel genommen hätten.
Das sei umso problematischer, als von der Bauordnung der Verfassung her die Gesetzgebung als einzige Gewalt dazu berufen ist, alle grundlegenden Entscheidungen zu treffen, die wesentlich in die Grundrechte eingreifen.
Aber auch die Gerichte hätten sich in den meisten Fällen ihre Arbeit allzu leicht gemacht. Obwohl es während des Frühjahrs-Lockdowns bereits absehbar gewesen wäre, dass es insbesondere für die besonders weitreichenden Eingriffe keine Rechtsgrundlage gegeben habe, hätte man Eilverfahren nach dem Fließbandprinzip abgebügelt.
Die Freiheit werde zunehmend als Ausnahme, der staatliche Angriff als Regelfall betrachtet. Auch auf detailliert dargelegte Sachargumente werde in den meisten Fällen nicht eingegangen:
„Bausteinartige, nicht individuell angepasste Beschlüsse, bei denen teilweise sogar die ursprünglichen Rechtschreib- und Grammatikfehler übernommen wurden, sind hierbei keine Seltenheit.“
„Außerrechtliche Moralisierung“ überlagert den Rechtsstaat
Statt von Recht und Gesetz ließen sich auch die Gerichte, so Hamed, „offenbar von gesamtgesellschaftlichen Erwägungen und einer öffentlich eingeforderten außerrechtlichen Moralisierung leiten“.
Es habe gedauert, bis sich Autoritäten wie der frühere Bundesverfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier kritisch geäußert hätten, erst dann hätte sich der Bundestag dazu durchgerungen, überhaupt eine formale Rechtsgrundlage zu schaffen. Mit dieser habe der Bundestag allerdings „erneut seine Entscheidungshoheit an die Exekutive abgegeben“.
In einem freiheitlich verfassten Gemeinwesen sei es nicht der Einzelne, der seine Freiheit, sondern der Staat, der seine Grundrechtseingriffe rechtfertigen müsse. Es seien auch nicht Wissenschaftler bestimmter Disziplinen, die den Rahmen für Antworten auf gesellschaftliche Fragen vorgeben, sondern die Verfassung.
Evidenzbasierte Einschätzungen spielen für Exekutive häufig keine Rolle
Die Regierung halte sich in ihrer Corona-Politik jedoch nicht einmal an die evidenzbasierten Einschätzungen jener unter den durchaus mit unterschiedlichen Meinungen aufwartenden Wissenschaftlern, deren Position sie teilten. Stattdessen herrsche auch nach einem Jahr noch „operative Hektik“ und es werde keine klare Aussage gemacht über die Entscheidungsbasis noch über das konkrete Ziel.
Ein „trauriges Paradebeispiel“ für „ungezielten, kopflosen Aktionismus der Regierenden“ sei in diesem Zusammenhang „die ersichtlich epidemiologisch absurde und willkürlich festgelegte 15-km-Grenze“ bezüglich des zulässigen Bewegungsradius.
Keine Abwägung der Interessen mehr
Die Verfassung schreibe bei kollidierenden Interessen eine Abwägung vor, unterstreicht die Rechtsanwältin. Seit Beginn der Krise werde einseitig und ohne politische Debatte der Viren-bezogenen Gesundheit der Vorzug gegenüber allen anderen Interessen gegeben. Eine Gesellschaft bestehe allerdings „aus mehr als nur Viren, Leben und Gesundheit“.
Mithilfe moralisierender Floskeln und einer Abwertung von Gegenpositionen werde der Meinungskorridor verengt. Dazu käme emotionale Erpressung mit regierungsamtlicher Rückendeckung – wie in Spots, in denen rhetorisch gefragt werde, ob „ein Weihnachten schön sei, wenn es Opas letztes werde“.
Die vorwiegend auf Angst setzende Rechtfertigungskampagne der Regierung, die schon zu Beginn der Krise in einem Papier als legitime Strategie vorgestellt worden sei, werde jedoch auch in Medien nicht kritisch hinterfragt.
Gesellschaft in „Schock- und Angststarre“
Ungeachtet der Gefährlichkeit des Virus vor allem für bestimmte Bevölkerungsgruppen habe jeder Mensch in einem freien Gemeinwesen das Recht, selbst zu entscheiden, wie er mit Risiken umgehe. Die Politik traue der Bevölkerung aber offenbar nicht zu, vernünftige und richtige Entscheidungen zu treffen.
Zudem zielten das Framing der Debatte und das Unterbinden von Gegenpositionen darauf ab, den Menschen diese Verantwortung vollständig zu nehmen. Es bleibe nur die „Scheinverantwortung“, die darin bestehe, alle Regeln zu befolgen.
Dieser Trend fresse sich allerdings schon länger in die Gesellschaft:
„Dass heute immer noch eine Art gesellschaftliche Schock- und Angststarre zu beobachten ist, die es vielen Menschen unmöglich zu machen scheint, andere Meinungen auszuhalten oder sogar intellektuell nachzuvollziehen, ist für mich ebenfalls ein Ausdruck des verengten Meinungskorridors, der auch dadurch entstanden ist, dass seit Monaten eine Angstnachricht die nächste jagt.“
Eine Gesellschaft, die frei bleiben wolle, müsse allerdings immer auch ein gewisses Restrisiko hinnehmen, das sich aus menschlichem Handeln ergebe.

Reinhard Werner schreibt für Epoch Times zu Wirtschaft, gesellschaftlichen Dynamiken und geopolitischen Fragen. Schwerpunkte liegen dabei auf internationalen Beziehungen, Migration und den ökonomischen Folgen politischer Entscheidungen.
Aktuelle Artikel des Autors
5. Dezember 2025
Schulstreik gegen neuen Wehrdienst: Proteste in über 50 Städten
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.