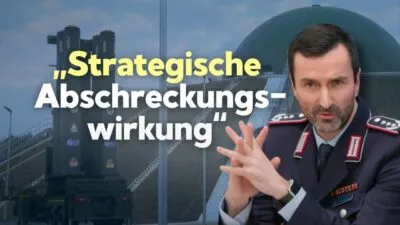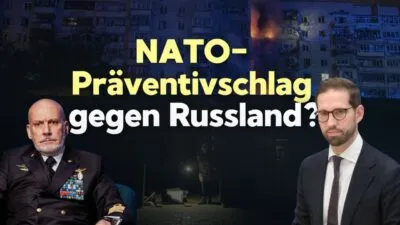Elektromobilität
Strom fürs E-Auto aus dem Boden: Ladebordstein ist serienreif
Bodeneben, wetterfest und robust: Der Rheinmetall-Ladebordstein soll die Elektromobilität weiter voranbringen. In Köln hat der Konzern zusammen mit der Stadt ein Jahr lang dieses neuartige Konzept getestet.

Der Rheinmetall-Ladebordstein ist bereit für die flächendeckende Einführung.
Foto: Rheinmetall AG
In den vergangenen Jahren sind im deutschen Bundesgebiet Ladesäulen für Elektrofahrzeuge wie Pilze aus dem Boden geschossen. Inzwischen gibt es insgesamt rund 167.000 öffentliche Ladepunkte (Stand: 1. Mai 2025). Doch nun hat ein neues Konzept Serienreife erlangt: der Ladebordstein.
Der Ladepunkt ist damit direkt in den Boden integriert, wie eine Steckdose am Straßenrand. Für den Ladevorgang müssen die Besitzer eines E-Autos einen QR-Code an der Vorrichtung scannen und ihr Gefährt mit ihrem Ladekabel mit der Buchse im Bordstein verbinden. Und schon lädt der Akku.
Mehr als 2.800 Ladevorgänge
Gut ein Jahr haben die Stadt Köln, der Ladeinfrastrukturbetreiber TankE GmbH und die Rheinmetall AG mit einer Felderprobung insgesamt vier Ladebordsteine im öffentlichen Straßenraum getestet. In einer Pressemitteilung bezeichnet Rheinmetall den Versuch als erfolgreich.
Das Pilotprojekt startete im April 2024 an zwei Standorten in Köln-Lindenthal. Ziel war es, die Praxistauglichkeit und die Akzeptanz der innovativen Ladelösung über einen Zeitraum von zwölf Monaten zu ermitteln.
Laut Rheinmetall gab es in der Testphase mehr als 2.800 erfolgreiche Ladevorgänge – durchschnittlich rund zwei pro Tag und Ladepunkt. Dabei lag die technische Verfügbarkeit bei über 99 Prozent. Mit dem Abschluss des Pilotprojekts werden die vier Ladepunkte jetzt in den Regelbetrieb überführt, so der Rüstungskonzern.
Das Laden soll auch bei Regen möglich sein. Laut der Website des Unternehmens ermöglichen dies gekapselte Elektronikkomponenten (IP68) und die mit Dichtungen und Wasserabläufen versehene Ladebuchse.
Falls sich doch Wasser anstauen und einen sicheren Ladevorgang beeinträchtigen sollte, unterbricht ein Wasserstandsensor den Ladevorgang, bevor der Fehlerstromschutzschalter (RCD oder FI) auslöst.
Schaltschrank statt Ladesäule?
Christoph Müller, CEO der Rheinmetall-Division Power Systems, teilte hierzu mit: „Bei unserem Produkt wird die Ladeelektronik in die Maße eines handelsüblichen Bordsteins integriert, um das Laden von Elektrofahrzeugen direkt am Fahrbahnrand zu ermöglichen.“ Dabei gebe es keine störenden Poller, Eingriffe in den Gehwegbereich oder Kompromisse in puncto Sicherheit oder Ästhetik.
Einen weiteren Eingriff in den Gehwegbereich scheint es aber dennoch zu geben. Laut dem YouTube-Kanal Strombock wurde für den Ladebordstein auf dem Gehweg vor den Parkplätzen ein neuer Schaltschrank installiert.
Im Weiteren bezeichnete Müller den Ladebordstein als „innovative Lösung“ für die Mobilitätswende. „Mit dem von uns entwickelten Ladebordstein steht ein serienreifes Produkt zur Verfügung, das urbane Ladeinfrastruktur neu denkt: platzsparend, robust, barrierearm – und integriert in bestehende Stadtstrukturen.“
Bewertung: 4,38 von 5 Punkten
Die Ladebordsteine haben im Probebetrieb insgesamt mehr als 50.000 Kilowattstunden (kWh) Ladeenergie abgegeben. Im Durchschnitt sind das rund 19 kWh pro Ladevorgang, was einer Reichweite von etwa 120 Kilometern entspricht. Die Installations- und Betriebskosten bezeichnet Rheinmetall als reduziert, da etwa die Wartung einfach und schnell erfolgen soll.
Begleitend zu der Felderprobung haben 100 Nutzer zwischen August 2024 und März 2025 ihre Erfahrungen mit dem Ladebordstein geteilt. Im Durchschnitt bewerteten sie das neue Ladekonzept mit 4,38 von 5 möglichen Gesamtpunkten. Die Nutzer schätzten insbesondere die Chance der flächendeckenden Einführung einer Lademöglichkeit vor Ort sowie die einfache Bedienbarkeit.
Gegenüber herkömmlichen Ladesäulen punktete der Rheinmetall-Ladebordstein auch bei Themen wie dem Einfügen in das vorhandene Stadtbild. Ebenso nannten die Nutzer Schutz vor Vandalismus, Platzersparnis, Sichtachsenwahrung und verringerte Gefahr von Stolperfallen durch Ladekabel als Vorteile.
Als nachteilig empfanden die Teilnehmer die geringe Sichtbarkeit des Ladebordsteins. Dieser Aspekt ließe sich durch gezielte Markierungen und die Integration in Navigations- und Lade-Apps verbessern.
Im Laufe des Pilotzeitraums wurden außerdem gezielte Weiterentwicklungen umgesetzt: Eine verbesserte Schmutzableitung sowie eine optimierte Beleuchtung rund um die Ladebuchse sorgen für eine noch höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und eine verbesserte Handhabung.
Das Fachgebiet von Maurice Forgeng beinhaltet Themen rund um die Energiewende. Er hat sich im Bereich der erneuerbaren Energien und Klima spezialisiert und verfügt über einen Hintergrund im Bereich der Energie- und Gebäudetechnik.
Aktuelle Artikel des Autors
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.