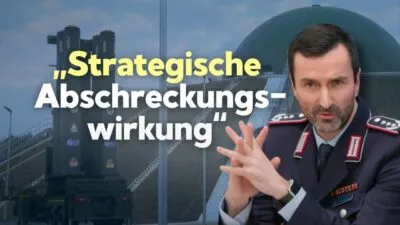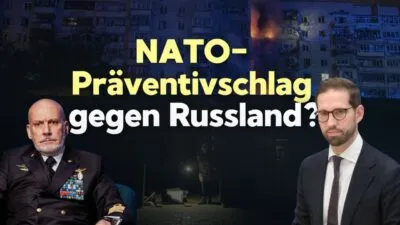Wahrscheinlich kennen wir alle die Situation, wenn wir uns beiläufig mit Dingen beschäftigen, die uns in unserer Entwicklung keinen Deut weiterbringen. Irgendwann wird uns plötzlich bewusst, dass wir kostbare Lebenszeit verschwendet haben.
Ein ähnliches Gefühl der Ernüchterung stellt sich ein, wenn wir uns in eine Onlinediskussion mit Unbekannten verwickeln lassen – eine Diskussion, die am Ende zu nichts führt und meist ein Gefühl der Frustration und Verbitterung hinterlässt. Oder wenn wir in Bildern von exotischen Urlaubszielen schwelgen, obwohl wir ganz genau wissen, dass wir aktuell gar nicht verreisen können.
Der Geschäftsstratege und Berater Cedrik Chin hat sich mit einer Frage beschäftigt, auf die viele von uns noch eine Antwort suchen: das Problem der Ablenkung. Chin hat erkannt, dass wir zu viel Zeit und Energie in Dinge stecken, die uns nicht weiterbringen – und zwar, ohne dass wir uns bewusst dafür entscheiden.
Chin hat sich mit klassischen Studien zum Thema Aufmerksamkeit befasst. Demnach ist die
menschliche Aufmerksamkeit begrenzt und sollte daher klug und umsichtig eingesetzt werden. Obwohl Chin viele Methoden ausprobierte, schien nichts sein Problem lösen zu können.
Schließlich griff er auf technische Maßnahmen zurück, wie eine „Informationsdiät“: Er löschte Apps, schaltete die Benachrichtigungsfunktion für X-Konten aus und versuchte, die Informationsflut einzudämmen. Trotzdem stellte er fest, dass er sich immer wieder ablenken ließ. Die Ablenkungen fanden ihren Weg zurück und nahmen seine Zeit allmählich wieder in Beschlag.
Das änderte sich eines Tages, als ihm ein Freund von einer
neuen Methode erzählte, die bei ihm Wunder vollbracht habe. „Der Kern dieses Ansatzes ist ganz einfach“, schilderte der Freund. „In jedem Moment, in dem du etwas tust oder liest, stellst du dir die Frage: Was versuche ich hier zu erreichen? – das ist alles. Das Ziel ist nicht, deine Zeiteinteilung zu kontrollieren, sondern dir in jedem Moment bewusst zu sein, warum du etwas tust. Wenn du das tust, wird sich deine Zeiteinteilung ganz von selbst ändern.“[1]
Von der Theorie in die Praxis
Für Chin hörte sich diese Empfehlung auf den ersten Blick unglaublich, fast trivial an, als hätte jemand gesagt: „Ernähre dich gesund und treibe regelmäßig Sport!“ Die Umsetzung war jedoch alles andere als leicht. Sie erforderte
ein hohes Maß an Selbstdisziplin und ständige mentale Präsenz. Als Chin anfing, dem Rat ernsthaft zu folgen, veränderte er sein Leben von Grund auf.
Einige Beispiele aus seiner Erfahrung:
„Ich höre mir bei der Hausarbeit einen Podcast an. Nach 15 Minuten frage ich mich: ‚Was will ich damit erreichen?‘ Die Antwort: ‚Nichts.‘ Die einzige Information, die ich erhalten wollte, bekam ich bereits nach 10 Minuten und danach ging es nur noch bergab. Also hielt ich inne und erledigte den Rest meiner Aufgaben in der Stille.“
Während einer Diskussion über die Geschlechtskontroverse im olympischen Boxen mit Freunden ertappt sich Chin, wie er sich mit dem Thema vertraut macht und in die Lektüre vertieft. Erneut überlegt er: „Was will ich damit erreichen?“ Dabei wurde ihm klar, dass er sich aus sozialen Gründen an der Diskussion beteiligte. Für sein eigenes Leben oder seine Arbeit war das Thema hingegen vollkommen irrelevant. „Ich mache es nur, weil meine Freunde im Gruppenchat darüber sprechen und ich Teil des Gesprächs sein möchte“, fand er heraus. Und das Resultat dieser Erkenntnis? „Ich mache weiter, bin mir aber jetzt des wahren Grundes bewusst, warum ich diese Sache tue – und höre auf, bevor sie meinen ganzen Nachmittag verschlingt.“
Ein weiteres Beispiel, das sicher viele kennen, ist folgende von Chin geschilderte Situation: „Ich sehe, dass jemand etwas wirklich Dummes auf X schreibt.“ Nachdem er eine bissige Antwort verfasst hat, fragt er sich erneut: „Was will ich damit erreichen?“ Seine Erkenntnis: „Ich will mich einfach nur gut fühlen – also lösche ich die Antwort.“
Irgendwann ertappte sich Chin am Ende eines langen Tages wieder einmal dabei, wie er ziellos durch den Kanal X scrollte. Dann öffnet er das Schreibfeld, um etwas zu twittern, fragt sich jedoch: „Was will ich damit erreichen?“ Die Antwort kam prompt aus dem Inneren: „Ich twittere, weil ich gelangweilt bin und etwas Aufmerksamkeit brauche.“
Das alles sei in Ordnung, schildert Chin. Nach dem Prinzip des ergebnisorientierten Denkens dürfe man weitermachen, wenn man sich über seine Motivation im Klaren sei. „Aber ich gebe zu, dass das ein ziemlich armseliger Grund ist und ich bessere und angenehmere Dinge zu tun habe“, so Chin und fügt hinzu: „Also höre ich auf.“
Neues Bewusstsein schafft Freiräume
Nach sechs Monaten, in denen er diese Herangehensweise trainiert hatte, spürte er eine deutliche Erleichterung auf mentaler Ebene. „Mein Kopf fühlte sich jetzt nicht mehr an wie eine überfüllte Bibliothek voller Informationen“, beschreibt er, sondern eher wie ein freies und aufgeräumtes Feld – „mit echtem Freiraum zum Atmen und Denken“.
Doch das war noch nicht alles: „Ich bin zuversichtlich, dass ich mich wirklich auf Dinge konzentrieren kann, die mir wichtig sind. Und was am wichtigsten ist: Ich fühle mich ermächtigt. Ich habe die volle Kontrolle darüber, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, und weiß, dass mir das niemand nehmen kann.“
Dank dieses neuen Bewusstseins lässt sich Chin auch nicht von politischen Debatten oder Medienrummel ablenken, sondern bleibt fokussiert. Und während die Leute um ihn herum „über das jüngste politische Fiasko oder das heiße Thema des Tages den Verstand verlieren“, schenke er den von Freunden geposteten Artikeln, Podcasts oder Videos nur das Nötigste an Aufmerksamkeit. „Ich nehme nur das heraus, was für meine Ziele wichtig ist“, wie er sagt, und dann setze er seine ursprüngliche Tätigkeit fort.
Die drei Stufen des Informationskonsums
Diese Methode bezeichnete Chin als „ergebnisorientiertes Denken“, die dritte und höchste Stufe in der Hierarchie des Informationskonsums. Diese baut sich wie folgt auf:
- Auf der ersten Stufe steht der ungefilterte Konsum, bei dem die Menschen alle möglichen Informationen in sich hineinströmen lassen, wie bei einem weit geöffneten Tor.
- Stufe zwei beinhaltet bereits einen Filter und setzt ein gewisses Bewusstsein voraus. Wer sich auf dieser Stufe befindet, baut einen „Schutzschild“ auf und blockiert unzuverlässige Quellen. Er verschafft sich eine relativ „saubere“ Informationsumgebung mit sorgfältig ausgewählten Quellen.
- In der dritten Ebene sind nach Chins Methode keine Mauern oder äußeren Beschränkungen mehr notwendig. Ein solcher Mensch kann frei im Ozean der Informationen schwimmen und in die Tiefe abtauchen, aber nur, um klar definierte und spezifische Ziele zu erreichen, die er sich zuvor selbst gesetzt hat.
Tatsächlich lässt sich diese Methode in fast jedem Lebensbereich anwenden. Wenn Sie etwa ein Buch lesen, können Sie es mit einem Ziel vor den Augen lesen, etwa wenn Sie die Antwort auf eine bestimmte Frage suchen oder den Wunsch nach einem tieferen Verständnis zu einem relevanten Thema verspüren. Wenn Sie sich das nächste Mal inmitten einer hitzigen Diskussion befinden, halten Sie einfach einen Moment inne und fragen sich: Was will ich damit erreichen?
Gespräche mit klarem Ziel
Diese Herangehensweise erinnert an eine Methode des US-amerikanischen Philosophen Peter Boghossian, ehemaliger Professor der Portland State University. In seinem gemeinsam mit Dr. James Lindsay veröffentlichten Buch beschrieb er diese Methode als „Impossible Conversations“ („Unmögliche Gespräche“). Demnach ist das oberste Gebot in jeder Unterhaltung, deren Ziel zu kennen. „Menschen beginnen Gespräche aus verschiedenen Gründen“, schreiben die Autoren. „Oft möchten sie einfach nur miteinander in Kontakt treten; in anderen Fällen verfolgen sie eher funktionale Ziele.“
Mögliche Ziele eines Gesprächs seien beispielsweise: die Position des Gegenübers zu verstehen, ohne ihr beizupflichten; von anderen zu lernen, also zu verstehen, wie er zu seinen Schlussfolgerungen kommt;
die Wahrheit zu finden; die Überzeugungen des anderen ändern zu wollen oder einfach den Gesprächspartner beeindrucken zu wollen.[2]
Tatsächlich hat Chin also keine neue Methode erfunden, sondern lediglich ein bekanntes Prinzip aus der Forschungsliteratur im Alltag konkret umgesetzt.
Aus Studien zur kognitiven Forschung ist bekannt, dass die menschliche Aufmerksamkeit über zwei Hauptmechanismen funktioniert: die Reaktion auf äußere Reize wie Geräusche oder Bewegungen innerhalb des eigenen Blickfeldes, auch Bottom-up genannt, sowie die Reaktion auf zuvor festgelegte Ziele, das sogenannte Top-down.[3]
Wenn wir uns vor einer bestimmten Handlung ein klares Ziel setzen, aktivieren wir den Top-down-Mechanismus unserer Aufmerksamkeit. Dieser lenkt unsere Aufmerksamkeit auf das, was in dem jeweiligen Moment von Bedeutung ist. Er hilft auch dabei, irrelevante Informationen und Reize herauszufiltern. Mit anderen Worten: Je nachdem, was wir suchen, lernt das Gehirn, zwischen Wesentlichem und Nebensächlichem zu unterscheiden.
Dieser Ansatz wird auch von Untersuchungen im Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie bestätigt. Die klassische Zielsetzungstheorie von Prof. Edwin Locke und Prof. Gary Latham – eine der verbreitetsten Motivationstheorien – zeigt, dass klare Ziele wie „Scheinwerfer“ wirken. Diese beleuchten die Reize und Handlungen, die mit dem Erreichen des Ziels zusammenhängen. Die nicht relevanten Ablenkungen hingegen werden verdunkelt oder verdrängt.[4]
Prinzip auf Wirtschaft übertragbar
Anthony Ulwick, Gründer der Beratungsfirma Strategyn, ging ähnlich wie Chin vor, allerdings hat er dieses Prinzip in den Kontext der Geschäftswelt übertragen.
Er entwickelte eine innovative Marketingmethode, welche die gewünschten Ergebnisse des Kunden in den Mittelpunkt des Entscheidungsprozesses stellt. Im Gegensatz zum traditionellen Marketing, das meist auf demografischen Merkmalen oder Produkteigenschaften basiert, wollte Ulwick systematisch verstehen, was der Kunde erreichen will. Daraus sollten sodann die Bedürfnisse, Chancen und einzelnen Schwerpunkte für neue Produkte und Dienstleistungen abgeleitet werden.[5]
Anstatt zu fragen: „Was muss das Produkt enthalten?“, lautete seine zentrale Frage: „Welche Ergebnisse möchte der Kunde erzielen?“
Prof. Clayton Christensen von der Harvard Business School entwickelte ein ähnliches Konzept namens „Jobs to be Done“ (zu erledigende Aufgaben). Wie das funktioniert, erklärte er anhand eines Falls von McDonald’s:
Das Unternehmen wollte sein Milchshake-Sortiment erneuern, um den Umsatz zu steigern. Dazu erstellten sie ein Kundenprofil und fragten die Kunden: „Wie können wir den Milchshake verbessern, damit Sie mehr davon kaufen?“[6]
Es gab viel Feedback, woraufhin die Milchshakes verbessert wurden – aber die Verkaufszahlen stagnierten. „Dann“, so Christensen, „schlugen wir ihnen vor, einen ganz anderen Ansatz auszuprobieren: Sie sollten begreifen, welche ‚Aufgabe‘ der Milchshake erfüllen soll.“
Am nächsten Morgen stand ein Forscher vor McDonald’s und befragte die Kunden, warum sie morgens um halb sieben extra wegen eines Milchshakes kamen. „Wir fragten sie: Stellen Sie sich eine ähnliche Situation vor, in der Sie die gleiche ‚Aufgabe‘ erledigen müssten, die der Milchshake für Sie erledigt – was würden Sie stattdessen ‚anheuern‘?“
Einer der Kunden verwies auf eine Banane, die in der letzten Woche die „Aufgabe“ des Milchshakes übernehmen sollte, aber vergebens. „Ich war in weniger als einer Minute fertig“, erklärte er. „Der Milchshake ist dickflüssig und der Strohhalm dünn, sodass ich 23 Minuten benötige, um ihn zu trinken. Das entspricht genau meiner Fahrzeit zur Arbeit.“
Viele andere gaben ähnliche Antworten. Die „Aufgabe“ habe darin bestanden, eine langweilige Fahrt zu überbrücken und sich bis 10 Uhr morgens satt zu fühlen, schilderte der Professor. Die Kunden „heuerten“ den Milchshake also an, um diese „Aufgabe“ zu erledigen.
In einer von Christensen gemeinsam mit Kollegen veröffentlichten Publikation heißt es, dass sich „Aufgaben“ in Umfang und Komplexität unterscheiden. Neben kleineren „Aufgaben“ – wie die Wartezeit beim Arzt zu überbrücken oder ein gesundes Pausenbrot für das Kind zuzubereiten – gebe es auch größere, komplexere und bedeutungsvollere Arbeiten wie eine erfüllende Karriere oder den Übergang in eine neue Lebensphase. [7]
Unternehmen erhöht Umsätze um 25 Prozent
Als Beispiel führten die Autoren den Fall eines Bauunternehmens in der Nähe von Detroit an, das Luxuswohnungen für Rentner baute. Diese Wohnungen waren für ältere Herrschaften gedacht, die nach dem Auszug der Kinder in großen, leer stehenden Privathäusern zurückblieben und in eine komfortable Wohnung ziehen wollten, wo alle notwendigen Dienstleistungen in unmittelbarer Nähe verfügbar waren.
Das Konzept schien vielversprechend. Die Wohnungen waren neu, geräumig und stilvoll eingerichtet. Und tatsächlich gab es viele potenzielle Kunden, die sich die Wohnungen ansahen – aber zum Kauf kam es nur in äußerst seltenen Fällen. Daran änderte sich auch nichts, als das Unternehmen die Wohnungen verbesserte. Die Verkaufszahlen blieben schwach.
Erst als die Firma ihre Perspektive änderte, folgte die Wende – mit der Erkenntnis, dass das eigentliche Produkt nicht die Wohnung war, sondern die Unterstützung bei einem emotionalen und praktischen Übergang zwischen verschiedenen Lebensphasen. Die Kunden brauchten nicht nur neue vier Wände, sie waren vor allem auf Hilfe angewiesen, um aus einem Haus voller Erinnerungen an einen neuen, unbekannten Ort umzuziehen.
Mit dieser Erkenntnis begann das Unternehmen, Dienstleistungen anzubieten, die diese „Aufgabe“ erledigen sollten: Beratungen und Hilfe bei der Entscheidung, welche Gegenstände aussortiert und welche mitgenommen werden sollen, die Möglichkeit, Dinge für zwei Jahre zu lagern, logistische Unterstützung beim Umzug und vieles mehr.
Und was passierte? Als sich das Unternehmen nicht nur auf das Produkt, sondern auf die eigentliche „Aufgabe“ konzentrierte, die der Kunde bewältigen wollte, stellte sich auch der Erfolg ein. Die Umsätze stiegen um rund 25 Prozent.
Es ist also alles eine Frage, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken; der Fokus auf das Wesentliche macht den Unterschied. Wer dieses Prinzip verinnerlicht, gewinnt nicht nur Kontrolle über seine Gedanken, sondern auch Zeit und Energie für die wirklich wesentlichen Dinge des Lebens. Wahre Stärke besteht darin, das Wesentliche niemals aus den Augen zu verlieren.
Quellen:1 Chin,
„Outcome Orientation as a Cure for Information Overload“, Commomcog.com
2 Maya Mizrahi, „How to have Impossible Conversations?“, Epoch Magazine, September 2022
3 Fumi Katsuki, Christos Constantinidis
„Bottom-up- und top-down-Aufmerksamkeit: unterschiedliche Prozesse und überlappende neuronale Systeme“, Neuroscientist, 2014
4 Edwin A. Locke, Gary P. Latham,
„Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35Year Odyssey“, American Psychologist, 2002
5 Anthony W. Ulwick,
„Turn Customer Input into Innovation“, HBR, 2002
6 Clay Christensen,
„The Jobs to be Done Theory”, YouTube, 2019
7 Christensen, Hall, Dillon, Ducan,
„Know Your Customers’ ‚Jobs to Be Done‘”, Harvard Business Review, 2016