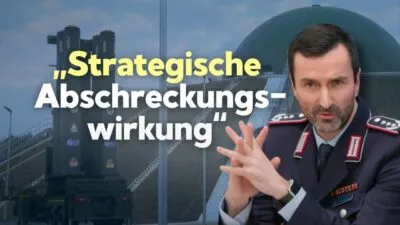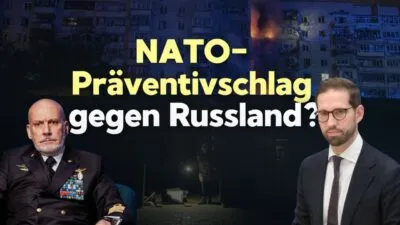Zwischen Krieg, Klimazielen und Zöllen: Dänemark übernimmt EU-Ratspräsidentschaft
Am 1. Juli 2025 hat Dänemark turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft von Polen übernommen. In einer von Unsicherheiten geprägten Zeit will das Land Stabilität und Richtung geben: vom Ukraine-Krieg über Aufrüstung und Wirtschaft bis zu Klimapolitik und Asyl.

Dänemark übernimmt für die kommenden sechs Monate den EU-Ratsvorsitz.
Foto: Tobias Schwarz/AFP via Getty Images
Am Dienstag, 1. Juli, hat Dänemark für die zweite Hälfte des Jahres 2025 die EU-Ratspräsidentschaft von Polen übernommen. Es ist damit das achte Mal, dass das Land diese Funktion ausfüllt.
Das Land, das die Ratspräsidentschaft innehat, soll unter anderem innergemeinschaftliche Debatten moderieren und zur Findung von Kompromissen beitragen. Auch führt die jeweilige Ratspräsidentschaft Verhandlungen mit dem EU-Parlament über die Gesetzgebung.
Multiple Herausforderungen und unsichere Zeiten
Im Interview mit „The Parliament“ äußert der ständige Vertreter Dänemarks, Carsten Grønbech-Jensen, die rotierende Ratspräsidentschaft sei ein Faktor, der Identifikation schaffe. Anders als während der Präsidentschaften 2002 und 2012, die Grønbech-Jensen ebenfalls mitgestaltet hatte, sei die Aufgabe dieses Mal nicht berechenbar:
„Es gibt so viele nicht vorhersehbare Faktoren, die die Agenda beeinflussen. Das macht es schwer, vorherzusagen, was passieren wird.“
Die dänische Präsidentschaft beginnt im Angesicht eines anhaltenden Krieges in der Ukraine, der noch nicht beendeten Operation Israels gegen die Hamas sowie Unsicherheiten mit Irans Atomprogramm. Dazu kommen eine anhaltende Stagnation der europäischen Wirtschaft, wachsende Widerstände gegen den Green Deal und Fragen wie die Aufrüstung.
Dänemark gehört dabei zu den Verfechtern eines Konfrontationskurses gegenüber Russland und einer anhaltenden Unterstützung der Ukraine. Die Regierung in Kopenhagen hat bislang fast 9 Milliarden Euro für Waffen an die Adresse der Führung in Kiew bereitgestellt.
Dänemark nicht mehr Teil der „frugalen Vier“
Die Sicherheitspolitik wird auch einer der Schwerpunkte der dänischen Ratspräsidentschaft sein. Um die Aufrüstung der EU zu ermöglichen, die der ReArm Europe Plan/Readiness 2030 vorsieht, ist Dänemark auch von seiner früheren Position eines strikten Sparkurses abgewichen. Noch 2020 war das Land zusammen mit den Niederlanden, Österreich und Schweden Teil der „frugalen Vier“.
Diese wandten sich in der Corona-Zeit gegen eine Ausweitung des EU-Haushalts. Heute will Mette Frederiksen davon nicht mehr viel wissen. Die „Welt, die unsere Freiheit gesichert und unseren Wohlstand ermöglicht hat“, zitiert „Euronews“ die seit 2019 regierende Ministerpräsidentin, könne „nicht länger als selbstverständlich angesehen werden“.
Bislang sind es vereinzelte Länder, die offen gegen eine weitere militärische Unterstützung und Sanktionen gegen Russland auftreten. Ungarn und die Slowakei gehören dazu. Die Slowakei zeigt sich auch skeptisch bezüglich einer weiteren Aufrüstung.
Kopenhagen sieht sich als Vorreiter bei Netto-Null
Dänemark ist auch unter den Musterschülern im Bereich des Green Deal. Mittlerweile kommen rund 80 Prozent der elektrischen Energie, die im Land produziert wird, aus erneuerbaren Quellen. Botschafter Grønbech-Jensen zeigt sich über die Entwicklung erfreut und sieht die Transformation der Energieversorgung weiterhin als zentrales Ziel:
„Der Übergang zur grünen Energie wird uns ein Ende der Abhängigkeiten von [ausländischen] Energieträgern ermöglichen. Das betrifft russische ebenso wie fossile Energieträger aus anderen Ländern. Entsprechend ist das auch eine Frage der Energiesicherheit.“
Der Botschafter sieht die grüne Transformation auch als „Teil der Agenda für Wettbewerbsfähigkeit“. Dänische Unternehmen hätten dadurch „ihr Wachstum und ihre Wettbewerbsfähigkeit gesteigert“. Diese sei „Teil der Modernisierung unserer Wirtschaft, die auch die europäische Wettbewerbsfähigkeit steigert“. Deshalb sei der Green Deal „bestimmt nicht aus der Mode“.
Stromkosten noch höher als in Deutschland
Inwieweit andere EU-Länder diese Einschätzung teilen und Dänemark tatsächlich als Vorbild taugt, ist ungewiss. Dänemark hat gerade einmal 6 Millionen Einwohner. Sein Kernstaatsgebiet – ohne die Färöer und Grönland – ist etwa halb so groß wie Österreich. Obwohl das Land an der Nord- und der Ostsee liegt und damit ähnlich geeignet für Windkraft ist wie Schleswig-Holstein, weist Dänemark laut Verivox sogar höhere Strompreise als Deutschland auf. Weltweit ist die Kilowattstunde nur auf den Bermudas teurer.
Neben der Skepsis, auf die Dänemarks Klimatransformationspolitik in Teilen der EU stoßen könnte, drohen dem Land auch Unwägbarkeiten mit den USA. Zum einen belasten die Ambitionen von US-Präsident Donald Trump, mehr Kontrolle über das staatsrechtlich zu Dänemark gehörende Grönland zu erlangen, die bilateralen Beziehungen, hinzu kommt die Zollproblematik.
Eskalation des Zollstreits würde Exportland Dänemark unter Druck setzen
Ein weiteres Thema, das Dänemark ins Zentrum seiner EU-Ratspräsidentschaft stellen möchte, ist die EU-Erweiterung. Letztmalig hatte eine solche 2013 stattgefunden, als Kroatien Mitglied der Staatengemeinschaft wurde. Nun strebt Brüssel weitere Beitritte an – insbesondere von Westbalkanländern, Moldau und der Ukraine. Vor allem Ungarn hat jedoch angekündigt, sich einem Beitritt des kriegsgeschüttelten Landes zu verweigern.
Befürworter restriktiver Asylpolitik versprechen sich Rückenwind
Konsensfähiger könnte der Ansatz Dänemarks in der Flüchtlingspolitik sein. Das Land gilt als Vorbild für mehrere andere Mitgliedstaaten, wenn es darum geht, durch restriktive Maßnahmen Asylsuchende von seinen Grenzen fernzuhalten. Im Jahr 2024 gewährte Kopenhagen laut dem „Nordschleswiger“ nur noch 860 Personen Asyl, der niedrigste Stand in 40 Jahren – wobei ukrainische Kriegsflüchtlinge nicht mitgezählt sind.
Es ist davon auszugehen, dass sich Mitgliedstaaten, die für eine besonders rigide Asylpolitik stehen, durch die dänische Ratspräsidentschaft Rückendeckung erhoffen. Zwar haben diese – anders als Dänemark selbst – keine Opt-out-Klausel aus einer gemeinsamen Asylpolitik, allerdings dürfte die EU-Ratspräsidentschaft bei der Umsetzung der Gemeinsamen Europäischen Asylpolitik (GEAS) eher als Beschleuniger denn als Bremser auftreten.
Die Regierung in Dänemark gilt zudem als Befürworter des von Großbritannien und Italien zeitweise gepflegten Modells, Asylsuchende in Drittländern unterzubringen. Hohe Kosten oder Gerichtsentscheidungen hatten diesem Vorgehen jedoch Grenzen gesetzt. Auch Flüchtlingshilfsorganisationen warnen davor, das dänische Modell zum Standard für ganz Europa erheben zu wollen.
Aktuelle Artikel des Autors
5. Dezember 2025
Schulstreik gegen neuen Wehrdienst: Proteste in über 50 Städten
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.