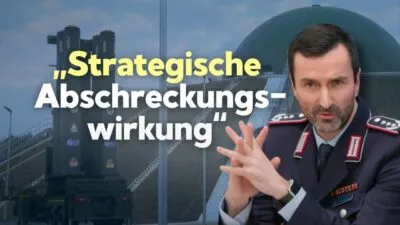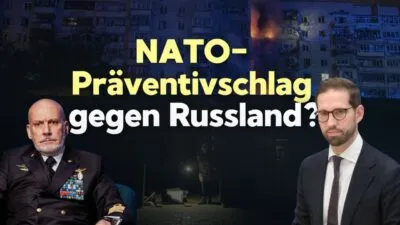Gökay Akbulut von den Linken hat sie nicht mehr, der AfD-Politiker Ingo Hahn ebenfalls nicht, hingegen schützt sie Robert Habeck (Grüne) weiterhin. Die Rede ist von der politischen – oder auch parlamentarischen – Immunität. Gemein haben alle drei Bundestagsabgeordneten, dass sie aufgrund möglicher schwerwiegender Vorkommnisse aufgehoben werden sollte.
Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung und eines manipulierten Videos
Ohne Aussprache hat der Bundestag am Donnerstag, 5. Juni 2025, einstimmig zwei Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung (
21/387,
21/388) zugestimmt. Er genehmigte somit die Aufnahme von Strafverfahren gegen Akbulut und Hahn. Auch im Fall Habeck lag ein Antrag auf Genehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens bei der Staatsanwaltschaft Dresden vor. Dieser wurde allerdings nicht erteilt (
21/389).
Gegen Gökay Akbulut, die seit 2017 für die Linke im Bundestag sitzt, laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Wie die
„Welt“ berichtete, soll sie in einem Zug, der von Heidelberg nach Stuttgart unterwegs war, eine Flasche nach einem Mann geworfen haben.
Die 42-Jährige behauptete auf ihrem
Instagram-Account, sie sei „
von Rechtsextremisten beleidigt und angegriffen“ worden. Die Polizei widersprach dieser Version allerdings, wie die „Welt“ aus einem internen Bericht erfuhr. Demnach lieferte sich die Politikerin mit Fans des VFB Stuttgart in dem Zug eine verbale Auseinandersetzung. Sie behauptete gegenüber den Ermittlern, dass die Fußballanhänger rassistische Parolen angestimmt hätten. Später habe sie sich korrigiert. So hätten die Männer „AfD, AfD“ gesungen. Die Polizei schreibt unter Berufung auf Zeugen weiter, dass Akbulut daraufhin eine Flasche in Richtung der Gruppe warf, die den Kopf eines Mannes nur knapp verfehlte. Aus der Gruppe flog daraufhin etwas zurück und traf die Linken-Politikerin am Kopf. Ob es sich bei dem Wurfgeschoss um eine Dose oder eine Flasche handelte, sei nicht klar.
Die parlamentarische Immunität Hahns hob der
Bayerische Landtag, dem er im vergangenen Jahr noch angehörte, bereits im Juli 2024 auf. Da er nach den vorgezogenen Bundestagswahlen nun Bundestagsabgeordneter ist, musste die Aufhebung erneut beschlossen werden.
Die Staatsanwaltschaft München wirft ihm vor, über soziale Medien ein Video veröffentlicht zu haben, in dem er die Rede einer Freie-Wähler-Abgeordneten aus dem Plenum aus dem Zusammenhang gerissen habe. Dazu habe er sie mit anderen Videoauszügen zusammengeschnitten. Diese Manipulation verstößt nach Ansicht der Staatsanwaltschaft gegen das Kunsturhebergesetz, daher beantragte sie die Aufhebung der Immunität.
Habecks angebliche BSW-Verleumdung sieht der Bundestag offenbar nicht
Der frühere Wirtschaftsminister Habeck sieht sich mit dem Verdacht der Verleumdung gegen das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt daher, doch der Bundestag stimmte einer Aufhebung der Immunität mehrheitlich nicht zu. Wie
Epoch Times berichtete, stimmte lediglich die AfD für eine
Aufhebung.
Das BSW und auch Wagenknecht selbst haben Anzeige wegen Verleumdung gegen den Grünen-Politiker erstattet. Das gab die Staatsanwaltschaft Dresden am 10. Juni
bekannt. Demnach hat die Strafverfolgungsbehörde ein Ermittlungsverfahren gegen Habeck aufgrund eines „bestehenden Anfangsverdachts […] wegen Verleumdung zum Nachteil des Bündnisses Sahra Wagenknecht“ und gegen Sahra Wagenknecht als Person des politischen Lebens eingeleitet. Über den Inhalt der Äußerung geht die Mitteilung nicht ein. Habeck hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Dresden am 30. August 2024 gesagt
(YouTube-Video ab Minute 1:20): „Sich aber für seine Meinung bezahlen zu lassen, im Internet Stimmen zu kaufen, Trollarmeen aufzubauen, […] ist widerlich, und das gehört sich nicht. Und wir wissen, dass die AfD und BSW genau so bezahlt werden.“
Die Immunität von Abgeordneten ist im
Artikel 46 des Grundgesetzes festgeschrieben. Dort ist auch geregelt, wann diese aufgehoben werden darf. Dazu nennt das Gesetz drei Anlässe: Straf- und Bußgeldverfahren, Zwangsmaßnahmen (Durchsuchung, Beschlagnahmung) oder Verhaftung. Ein weiterer Anlass ist die „Zivil- oder Verwaltungsvollstreckung mit Körperzwang“. Darunter versteht man die Erzwingungshaft. Die rechtliche Grundlage dafür regelt
§ 107 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Bundestages (GOBT), da gerichtliche Vollstreckungsmaßnahmen, die in die Freiheit eingreifen, der Genehmigung bedürfen.
Damit Behörden aber auch im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Abgeordnete ihre Arbeit überhaupt aufnehmen können, erteilt der Bundestag ihnen zu Beginn einer jeden Wahlperiode eine Blankogenehmigung. Wird ein Abgeordneter „auf frischer Tat“ ertappt und auch innerhalb des folgenden Tages festgenommen, kann das die Polizei auch ohne Genehmigung des Parlaments tun. Dieses muss aber informiert werden und kann die Haft unter Hinweis auf Artikel 46 des Grundgesetzes beenden. Nicht tätig werden dürfen Ermittler, wenn parlamentarische Tätigkeiten (politische Äußerungen) betroffen sind.
Die Urfassung der Immunität stammt aus dem Jahr 1849
Die Geschichte der politische Immunität geht zurück auf die Anfänge der Frankfurter Nationalversammlung. Sie tagte 1848/49 in der Paulskirche der Mainmetropole und bildete die erste Volksvertretung für ganz Deutschland. Damals verabschiedeten die Delegierten die Verfassung des Deutschen Reiches – und führten auch die Immunität der Abgeordneten ein. So heißt es in
§ 120 wörtlich: „Kein Mitglied des Reichstages darf zu irgend einer Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen der in Ausübung seines Berufes gethanen Aeusserungen gerichtlich oder disciplinarisch verfolgt oder sonst ausserhalb der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden.“
Die Immunität sollte ursprünglich die Abgeordneten vor willkürlicher politischer Verfolgung der Exekutive – damals oft in Form von monarchischer Herrschaft – schützen. Die sich konstituierende Legislative sollte vor Repressionen (Verhaftung, Anklage) bewahrt werden. Kritische Stimmen sollten nicht zum Schweigen gebracht werden.
Das war eng verbunden mit dem Streben nach freier Meinungsäußerung und dem Schutz parlamentarischer Debatten. Die gewählten Volksvertreter sollten offen und ungehindert debattieren können und nicht befürchten müssen, Opfer von politischer Verfolgung zu werden. Der § 120, der auch die Indemnität (inhaltlicher Schutz von Aussagen) beinhaltete, wurde Vorbild für die Reichsverfassung
von 1871 (Art. 30), die Weimarer
Reichsverfassung (1919, Art. 37) und das bereits erwähnte Grundgesetz (1949, Art. 46).
Reichsgericht sprach 1892 von Unverfolgbarkeit
Doch bald kam Kritik an der parlamentarischen Immunität auf. So zweifelte etwa das Reichsgericht im Jahr 1892 an, ob der Immunitätsschutz von 1871 für Abgeordnete überhaupt eine sinnvolle und gerechtfertigte Maßnahme ist. In seinem Urteil kritisierte das Gericht in einem Abschnitt (RGSt. 22, 379–388), dass die „Genehmigung des Reichstags“ zu einer Strafverfolgung oft nicht eingeholt werden konnte, schrieb das juristische Portal
„Legal Tribune Online“ (LTO).
Das sei auf die häufigen Verschiebungen von Sitzungen zurückzuführen, was „sich in höchst irrationaler Weise zu einem mit der Dignität eines Reichstagsmitglieds persönlich verknüpften Freibriefe der Unverfolgbarkeit und Straflosigkeit erweitern“ müsse. Das Gericht urteilte schlussendlich: „Ob derartige Exemtionen noch einen vernünftigen Sinn haben, ob sie mit den Grundsätzen der Rechtsgleichheit und den Bedürfnissen der Rechtsordnung verträglich sind, darf mit Grund bezweifelt werden.“
In dem Artikel wird der Jurist und Philosoph Wilhelm Raimund Beyer (1902–1990) erwähnt, der sich 1966 sehr kritisch zur parlamentarischen Immunität äußerte und sich dabei auf das Urteil des Reichsgerichts fast 75 Jahre zuvor berief. Beyer sah einen Verstoß gegen das Grundgesetz samt seinen vorangestellten Grundrechten, weil die Immunität Abgeordnete von für alle geltenden Regeln ausnehme.
Spektakuläre Fälle der Immunitätsaufhebung
In den vergangenen 25 Jahren hob das Parlament mehrfach die Immunität von Abgeordneten auf. Zu den spektakulärsten Fällen zählten die Voten zuungunsten von zwei damaligen SPD-Abgeordneten. Sebastian Edathy und Jörg Tauss gerieten wegen des Verdachts des Besitzes von Kinderpornografie in den Fokus von Ermittlern. Tauss wurde 2010 wegen des Besitzes von kinderpornografischen Schriften zu 15 Monaten Haft auf Bewährung
verurteilt. Er ist somit vorbestraft.
Edathy gestand vor dem Landgericht Verden, sich mit seinem Dienstlaptop Videos und Bilder heruntergeladen zu haben. Daraufhin stellte das Gericht den Prozess bereits am zweiten Verhandlungstag gegen eine Geldauflage von 5.000 Euro ein, berichtete
„LTO“ seinerzeit. Edathy war somit weder frei- noch schuldig gesprochen.
Während Tauss der SPD nicht mehr angehört, ist Edathy nach wie vor Mitglied. Seine Mitgliedschaft ruhte allerdings wegen des Vorfalls mehrere Jahre.