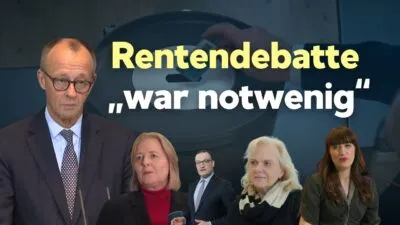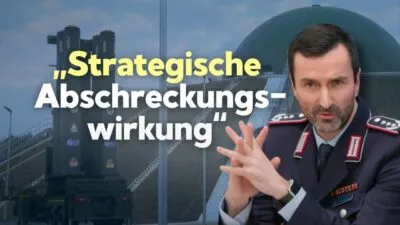Radikale Indoktrination der Schüler beenden: Trump unterzeichnet Dekret für "patriotische Erziehung"
Nur einen Tag vor den Wahlen unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung zur Förderung der "patriotischen Erziehung" durch die Einrichtung der Bundeskommission 1776.

Familie schwenkt amerikanische Flaggen.
Foto: iStock
Donald Trump schrieb am Vorabend des Wahltags: „Unterzeichnete gerade eine Anordnung zur Einrichtung der Kommission von 1776. Wir werden der radikalen Indoktrination unserer Schüler Einhalt gebieten und die PATRIOTISCHE ERZIEHUNG an unseren Schulen wieder einführen!“
Der Präsident bezog sich während seiner Kundgebung in Scranton, Pennsylvania, am Montag auf die Ausführungsanordnung.
„Ich habe diese Verordnung gerade unterzeichnet, um Ihren Schülern pro-amerikanische Werte zu vermitteln“, sagte Trump zu seinen Anhängern.
Der Präsident kündigte die Idee der Bildungskommission im September an, nachdem er versucht hatte, Statuen einiger amerikanischer Revolutions- und Kolonialfiguren, die bei den Unruhen im Zusammenhang mit dem Tod von George Floyd gestürzt wurden, wieder aufzustellen.
Geschichte in falsches Licht gerückt
Laut einiger Details des Dekrets, das am Montag auf der Website des Weißen Hauses veröffentlicht wurde, stellte die Trump-Administration fest, dass „die jüngsten Angriffe auf unsere Gründung die rassenbezogene Geschichte Amerikas hervorgehoben haben“.
Sie seien erfüllt mit „einseitiger“ und „spalterischer“ Rhetorik, die „das große Vermächtnis der amerikanischen nationalen Erfahrung – den tapferen und erfolgreichen Versuch unseres Landes, den Fluch der Sklaverei abzuschütteln und die Lehren aus diesem Kampf zu nutzen, um unsere Arbeit für gleiche Rechte für alle Bürger in der Gegenwart zu lenken“, ignoriere oder in ein falsches Licht rücke.
„In den letzten Jahren hat eine Reihe von Polemiken, die sich auf die schlechte Wissenschaft gründen, unsere Gründer und unsere Gründerväter verunglimpft“, fügte der Beschluss des Weißen Hauses hinzu. „Trotz der Tugenden und Errungenschaften dieser Nation werden heute viele Studenten in der Schule gelehrt, ihr eigenes Land zu hassen und zu glauben, dass die Männer und Frauen, die es aufgebaut haben, keine Helden, sondern eher Schurken waren“.
Die Bundeskommission wolle eine patriotische Sichtweise der amerikanischen Geschichte fördern, stellte jedoch fest, dass einige örtliche Schulen die Kontrolle darüber haben, welche Lehrpläne den Schülern vermittelt werden. Einige Demokraten sagten, sie würden sich der Bundesinitiative widersetzen.
„Eine Wiederherstellung des amerikanischen Bildungswesens, das auf den Prinzipien unserer Gründung beruht und das genau, ehrlich, vereinheitlichend, inspirierend und veredelnd ist, muss letztendlich auf lokaler Ebene gelingen. Eltern und lokale Schulbehörden müssen befähigt werden, eine größere Auswahl und Vielfalt in den Lehrplänen auf staatlicher und lokaler Ebene zu erreichen“, hieß es in der Verfügung.
1619-Projekt der New York Times ist „ideologisches Gift“
Diese Anordnung kam, nachdem Trump das umstrittene „1619-Projekt“ der New York Times kritisiert hatte.
„Die Linke hat die amerikanische Geschichte mit Täuschungen, Unwahrheiten und Lügen verzerrt, entstellt und verunreinigt“, sagte Trump im September. „Es gibt kein besseres Beispiel als das völlig diskreditierte „1619-Projekt der New York Times“.
Und er fügte damals hinzu: „Die Kritische Rassentheorie, das 1619-Projekt und die Kreuzzüge gegen die amerikanische Geschichte sind giftige Propaganda – ein ideologisches Gift, das, wenn es nicht entfernt wird, die bürgerlichen Banden, die uns aneinander binden, auflösen wird.“
Die Kritische Rassentheorie ist ein Ableger der von Karl Marx beeinflussten kritisch-theoretischen Sozialphilosophie, die von der Frankfurter Schule gefördert wurde. Einige auf der rechten Seite sehen in der Kritischen Theorie und in der Kritischen Rassentheorie langfristige Versuche, das amerikanische Gemeinwesen zu untergraben, um den Sozialismus oder Kommunismus in den Vereinigten Staaten herbeizuführen.
Das von der NY Times geförderte Projekt versuchte, die amerikanische Geschichte auf die Auswirkungen der Sklaverei und die Beiträge schwarzer Personen zu konzentrieren. Die Begründerin des Projekts, Nicole Hannah-Jones, wurde Anfang des Jahres mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.
Im Projekt wird behauptet, dass die amerikanische Revolution eher für die Erhaltung der Sklaverei als für individuelle Freiheit und natürliche Rechte stand. Am 6. September schrieb der Präsident, dass er Schulen, die das Projekt nutzen, nicht finanzieren werde.
NAS-Gelehrte fordern Streichung des Pulitzer Preises für Nicole Hannah-Jones
Die National Association of Scholars (NAS) forderte im Oktober das Pulitzer Prize Board auf, Hannah-Jones die Auszeichnung zu entziehen.
„Das Projekt als Ganzes wurde von ähnlichen Fehlern beeinträchtigt“, schrieben die NAS-Gelehrten und erklärten, dass prominente Historiker seit September 2019 auf die „schwerwiegenden sachlichen Fehler, fadenscheinigen Verallgemeinerungen und erzwungenen Interpretationen“ des Projekts hinweisen. Hannah-Jones „hat diese Kritik nicht widerlegt oder sie in respektvoller oder sinnvoller Weise beantwortet. Stattdessen wies sie sie zurück“, sagten sie.
Der Originalartikel erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Trump Signs Executive Order to Promote ‘Patriotic Education’ Day Before Election (Deutsche Bearbeitung von nmc)

Jack Phillips ist als Reporter für aktuelle Nachrichten bei der englischsprachigen Ausgabe der Epoch Times tätig und berichtet über eine Reihe von Themen, darunter US-Politik und Gesundheit. Der zweifache Familienvater wuchs im kalifornischen Central Valley auf. Folgen Sie ihm auf x.com/jackphillips5.n
Aktuelle Artikel des Autors
15. September 2025
Gängige Schmerzmittel senken Wirksamkeit von Antibiotika
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.