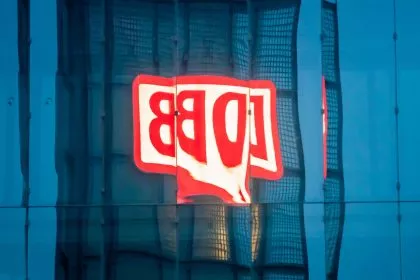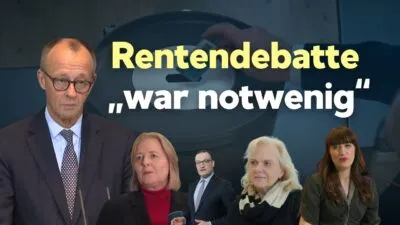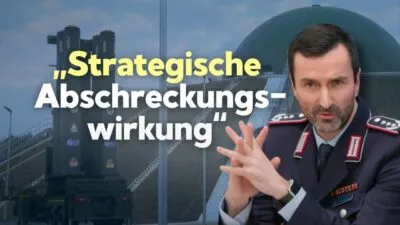Sensible Infrastruktur
Aussitzen bis 6G oder Nägel mit Köpfen? Minister beraten über Umgang mit Huawei
Am Donnerstag werden hochrangige Minister des Bundeskabinetts über den weiteren Umgang mit Komponenten des Hochrisikoanbieters Huawei im 5G-Netz beraten. Kritiker argwöhnen, der Bund wolle das Thema aussitzen, bis der nächsthöhere Standard im Mobilfunk ausgebaut wird.

Das Logo des chinesischen Technologiekonzerns Huawei ist am Eingang seines Messestandes beim Mobile World Congress (MWC) zu sehen.
Foto: Wolf von Dewitz/dpa
Bereits im Vorjahr hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser angekündigt, kritische Komponenten sogenannter Hochrisikoanbieter aus dem deutschen 5G-Netz zu entfernen. Gemeint sind dabei vor allem Bauteile von Konzernen wie Huawei oder ZTE, die dem chinesischen kommunistischen Regime nahestehen. Das Bundesverkehrsministerium agiert bislang zurückhaltend. Am Donnerstag, 23. Mai, wollen mehrere Minister des Bundeskabinetts zusammenkommen, um den Sachstand zu erörtern.
Derzeit bis zu 60 Prozent Huawei-Technik in deutschen 5G-Zugangsnetzen
Wie das „Handelsblatt“ berichtet, werden Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Bundesminister Nancy Faeser (Inneres), Volker Wissing (Verkehr), Annalena Baerbock (Auswärtiges) und Robert Habeck (Wirtschaft) an dem Treffen teilnehmen. Die Minister wollen in Sachen Huawei noch vor der parlamentarischen Sommerpause zu einem einheitlichen Vorgehen finden.
Bis 2025 sollen die Komponenten der Anbieter, vor denen auch die Nachrichtendienste warnen, zumindest aus den Kernnetzen entfernt sein. Im sogenannten Zugangs- und Transportnetz will Faeser den Anteil bis 2026 auf durchschnittlich 25 Prozent begrenzen.
In besonders heiklen Regionen wie der Hauptstadt Berlin oder der Industrieregion Rhein-Ruhr ist die Rede von einer vollständigen Entfernung. Gerade dort schätzen Experten den Anteil der Bauteile chinesischer Anbieter in deutschen 5G-Zugangsnetzen auf 50 bis 60 Prozent.
Wissing will nicht länger blockieren
Der auch für Digitales zuständige Minister Volker Wissing galt bis dato als Bremser bezüglich des Ausbaus der Bauteile. Er trat der Argumentation der Netzbetreiber selbst bei und deutete an, dass Selbstverpflichtungen der Unternehmen zu entsprechenden Sicherheitsstandards ausreichen würden. Zudem seien bereits die bestehenden Sicherheitsanforderungen nach dem Telekommunikationsgesetz streng genug, um schädliche Potenziale weitgehend auszuschalten.
Beobachter gehen davon aus, dass Wissings zögerliches Vorgehen in Sachen Huawei einen sehr pragmatischen Grund hat. Er sei sich des bereits jetzt als ausbaufähig geltenden Zustandes des Mobilfunknetzes in Deutschland bewusst – und befürchte noch mehr Funklöcher, würde man noch rascher die Komponenten entfernen.
Demgegenüber hatten zuletzt nicht nur die Nachrichtendienste, sondern auch Sicherheitsexperten aus dem Innenministerium zur Eile gedrängt. Das bestehende Risiko von Manipulationen, Sabotage oder Datenabfluss sei akut – und je länger man zögere, umso wahrscheinlicher hätten Schadensersatzklagen der Netzbetreiber Chancen auf Erfolg.
Die Führungsetage von Huawei
Nun gibt es dem „Handelsblatt“ zufolge einen Entwurf für ein gemeinsames Vorgehen. So soll in einer ersten Phase die Ausrüstung im Kernnetz bis zum 1. Januar 2026 entfernt werden. Für die meisten Anbieter macht das wenig Unterschied: Diese Teile sind bereits jetzt weitgehend entfernt.
Im Zugangs- und Transportteil der Netze soll die Frist zur Entfernung der Komponenten bis zum Jahr 2029 gestreckt werden. Für die Netzbetreiber sei die Lösung komfortabel: Die Frist würde dann bis zu jenem Zeitpunkt reichen, wo ein Austausch aufgrund der Lebensdauer der Teile ohnehin erfolgen müsse. Deutschland müsse mögliche Konflikte mit der Kommunistischen Partei Chinas (KPC), die diese veranlassen könnten, Huawei zum Abschalten der Netzteile zu bewegen, über mindestens fünf Jahre hinauszögern.
Die Konzerne Huawei und ZTE erklären, nicht mit Geheimdiensten oder Sicherheitsdiensten des Regimes in Peking zu tun zu haben. Tatsächlich verpflichten sie aber Gesetze der KPC dazu, deren Anordnungen zu befolgen. Zudem sind zahlreiche führende Manager entweder selbst Mitglieder der Kommunistischen Partei oder mit deren Führung eng verbunden.
Kosten für Netzbetreiber tatsächlich so unzumutbar?
„Wirtschaftswoche“-Redakteurin Nele Husmann kritisiert das Vorgehen der Ampel. De facto würde der Huawei-Ausschluss „auf den 6G-Netz-Ausbau verschoben“. Das US-Fachmedium „Light Reading“ schildert sogar, dass sich die Netzbetreiber nach wie vor mit Bauteilen bei Huawei eindeckten und dessen Präsenz im deutlich kostspieliger zu unterhaltenden Funkzugangsnetz (RAN) weiter wachse.
Von 91.000 Standorten von 5G-Basisstationen seien mindestens 45.500 mit Huawei-Antennentechnik ausgerüstet. Die Deutsche Telekom soll sogar nicht weniger als 65 Prozent ihrer Standorte mit Technologie des Hochtechnologieanbieters betreiben. Ein unmittelbarer Austausch würde pro Standort etwa 50.000 Euro und insgesamt 2,5 Milliarden Euro kosten. Für Husmann ein vertretbarer Aufwand für mehr Sicherheit:
„Dass die Konzerne die Mehrkosten tragen, ist nicht unzumutbar. Je Kunde kostet ein sofortiger Austausch 18 Euro.“
Reinhard Werner schreibt für Epoch Times zu Wirtschaft, gesellschaftlichen Dynamiken und geopolitischen Fragen. Schwerpunkte liegen dabei auf internationalen Beziehungen, Migration und den ökonomischen Folgen politischer Entscheidungen.
Aktuelle Artikel des Autors
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.