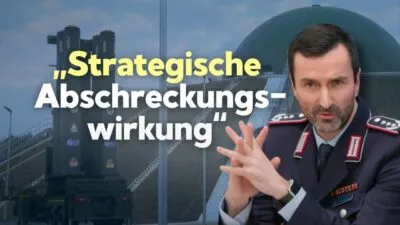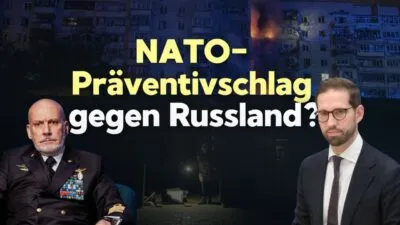Weltgesundheitsversammlung in Genf
WHO am Scheideweg: Zwischen Reformdruck und Einflussverlust
Bei der 78. Weltgesundheitsversammlung in Genf steht die WHO vor entscheidenden Weichenstellungen: Ein neues Pandemieabkommen, drohende Finanzierungslücken durch den US-Austritt und Reformforderungen bestimmen die Agenda – begleitet von wachsender internationaler Kritik.

Logo der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor dem Sitz in Genf.
Foto: Lian Yi/XinHua/dpa
0:00
Am Montag, 19. Mai, hat die 78. sogenannte Weltgesundheitsversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) begonnen. Bis zum 27. Mai werden in Genf die Delegierten aus den mehr als 190 Mitgliedstaaten geplante Vereinbarungen, Reformschritte und Fragen der künftigen Finanzierung ihrer Arbeit diskutieren.
Die USA hatten unmittelbar nach Amtsübernahme ihres 47. Präsidenten Donald Trump ihren Austritt aus der WHO erklärt. Der UNO-Sonderorganisation geht damit ihr bis dato größter Geldgeber verloren.
WHO zufrieden mit Einigung auf Pandemieabkommen – Punkte bleiben jedoch offen
Mit der Verabschiedung eines Pandemieabkommens strebt die WHO einen Prestigeerfolg in Anbetracht der zuletzt stärker gewordenen internationalen Kritik an. Neben den USA hat auch Argentinien einen Austritt angekündigt. In weiteren Ländern wie Italien gibt es ebenfalls Austrittsbefürworter auf Regierungsebene. Zwar besteht über einen solchen Schritt kein Konsens, allerdings ist ein erhöhter Reformdruck auf die Organisation zu erwarten.
Am 15. April hatte die WHO verlautbart, dass es den Mitgliedstaaten gelungen sei, sich nach mehrjährigen Debatten auf den Entwurf für ein „historisches“ Pandemieabkommen zu einigen. Dieses soll die weltweite Zusammenarbeit bei der Prävention, Vorsorge und Reaktion auf künftige Bedrohungen durch eine Pandemie stärken. Im Dezember 2021 hatte die Organisation ein „Zwischenstaatliches Verhandlungsgremium“ (INB) eingesetzt. Dieses sollte ein Übereinkommen aushandeln, um Zustände wie in der Zeit der Corona-Pandemie zu verhindern.
Um das Abkommen zu beschließen, reicht eine einfache Mehrheit aus. Üblicherweise sollten in weiterer Folge der Ratifizierungsprozess durch die Mitgliedstaaten und die Umsetzung auf nationaler Ebene durch Gesetze stattfinden. Diese können dabei auch Vorbehalte anbringen, eine Kündigung ist jedoch frühestens zwei Jahre nach Inkrafttreten vorgesehen.
PABS als noch zu klärender Themenkomplex
Die Ratifizierung wird jedoch noch bis mindestens 2026 auf sich warten lassen. Einige Fragen werden nämlich auch im Fall einer Verabschiedung des Pandemieabkommens noch offenbleiben. So sollen erst im nächsten Jahr die Details zum sogenannten PABS (Pathogen Access and Benefit System) stehen.
Diese soll eine Arbeitsgruppe zur technischen Umsetzung dieses Systems klären. Das PAB-System soll den Austausch von Informationen über neue Krankheitserreger, beispielsweise durch DNA-Sequenzen, beschleunigen. Darüber hinaus sollen Pharmaunternehmen einen Teil ihrer Produktion für ärmere Länder zur Verfügung stellen.
Weitere Punkte des PABS sollen die Förderung des Technologietransfers und den Austausch von Know-how zur Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen umfassen. Vor allem Pharmakonzerne und reichere Länder hatten sich in diesen Bereichen gegen Automatismen ausgesprochen. Dem Grunde nach hat man sich nun jedoch darauf geeinigt, dass Vertragsstaaten einander zeitnah Proben und genetische Daten von potenziell pandemischen Erregern zur Verfügung stellen. Im Gegenzug sichert man ihnen einen Anspruch auf Zugang zu Technologien und Produkten wie Impfstoffen und Medikamenten.
Sicherung der Finanzierung
20 Prozent der Produktion von Gesundheitsprodukten, die der WHO zur Verfügung gestellt werden sollen, gelten als Verhandlungsbasis. Ob diese gespendet oder zu einem ermäßigten Preis abgegeben werden sollen, ist noch offen. Zum Inkrafttreten des Abkommens sind mindestens 60 Ratifizierungen erforderlich.
Die Versammlung möchte zudem ihr 14. Arbeitsprogramm für die Jahre 2025 bis 2028 und Strukturreformen in eigener Sache beraten. Bedingt durch den Ausstieg der USA könnte bis zu einem Fünftel des Budgets der WHO wegfallen. Um die Finanzierung zu sichern, wird die Versammlung unter anderem über eine Anhebung der Pflichtbeiträge der Mitgliedstaaten und eine effizientere Mittelverwendung diskutieren.
Zu den Themen des Weltgesundheitsgipfels gehören auch die Umsetzung der vor allem für Krisengebiete relevanten Initiative Global Health for Peace und die Wahl neuer Mitglieder für den Exekutivrat. Die Versammlung will auch Maßnahmen zur Eliminierung der Malaria bis 2030 beratschlagen. Zudem erörtern die Delegierten den Umgang mit dem Anstieg nicht übertragbarer Krankheiten und eine Stärkung der allgemeinen Gesundheitsversorgung.
Was ist der Unterschied zwischen IHR und Pandemieabkommen?
Neben dem Pandemieabkommen soll es auch eine Anpassung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) geben. Kern der Änderung soll die Einführung einer Warnstufe „pandemischer Notfall“ sein, der zum bisherigen „gesundheitlichen Notfall von internationaler Tragweite“ (PHEIC) hinzutreten soll. Diese soll eine abgestufte, frühzeitige internationale Reaktion auf Ereignisse erleichtern, die bereits pandemisch sind oder ein Potenzial dazu besitzen.
Außerdem soll ein neues Implementierungsgremium die Umsetzung der IHR überwachen und die Staaten zur Einhaltung und Umsetzung anhalten. Die IHR sollen auch neue Grundlagen für den Einsatz digitaler Nachweise in Gesundheitskrisen schaffen – vergleichbar dem Impfzertifikat in der Corona-Zeit. Auch versucht man, auf deren Grundlage die konkrete Ausgestaltung des von der Organisation ausgegebenen Ziels, globale Lieferketten aufzubauen und zu optimieren.
Anders als das neue Pandemieabkommen, in dem es um Prävention, Vorsorge und Reaktionen geht, bestehen die IHR schon seit 2005. Sie befassen sich mit Meldepflichten, Überwachung und internationaler Reaktion auf Gesundheitsnotlagen. Beide Instrumente sind nicht deckungsgleich, allerdings gibt es Überschneidungen. Das Pandemieabkommen will vor allem verbindlichere und umfassendere Regelungen für Pandemien schaffen.
WHO will Sorge um Souveränität im Text Rechnung tragen
Um einen Konsens zu erreichen, hat die WHO im Schlussentwurf zum Pandemieabkommen auf besonders umstrittene Inhalte verzichtet – etwa solchen zur „reproduktiven Gesundheit“ oder zur Bekämpfung von „Fake-News“. Der Entwurfstext betont außerdem die Souveränität der Vertragsstaaten. Es findet sich explizit eine Klarstellung, dass es diesen obliege, „Fragen der öffentlichen Gesundheit innerhalb ihrer Grenzen zu regeln“. Der Abkommensentwurf sei nicht so auszulegen, dass er „der WHO die Befugnis einräumt, nationale Gesetze oder Strategien anzuweisen, anzuordnen, zu ändern oder vorzuschreiben“.
Zudem sei eine Befugnis der WHO ausgeschlossen, die Staaten zu beauftragen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Das gelte beispielsweise für Reiseeinschränkungen, Impfvorschriften, die Verhängung therapeutischer oder diagnostischer Maßnahmen oder Lockdowns.
Weder das geplante Pandemieabkommen noch die IHR geben der WHO hoheitliche Befugnisse gegenüber den Vertragsstaaten. Allerdings hatten insbesondere nationale Gerichte internationale Vereinbarungen wie das Pariser Klimaabkommen von 2015 mehrfach herangezogen, um den Spielraum der nationalen Gesetzgebung einzuschränken. Ähnliches befürchten Gegner einer engeren Zusammenarbeit unter dem Banner der WHO auch jetzt.
Gleichzeitig können nationale Regierungen geneigt sein, restriktive Maßnahmen im Bereich der Grundrechte mit Vereinbarungen auf WHO-Ebene zu rechtfertigen.
Reinhard Werner schreibt für Epoch Times zu Wirtschaft, gesellschaftlichen Dynamiken und geopolitischen Fragen. Schwerpunkte liegen dabei auf internationalen Beziehungen, Migration und den ökonomischen Folgen politischer Entscheidungen.
Aktuelle Artikel des Autors
5. Dezember 2025
Schulstreik gegen neuen Wehrdienst: Proteste in über 50 Städten
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.