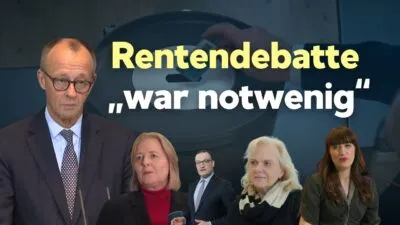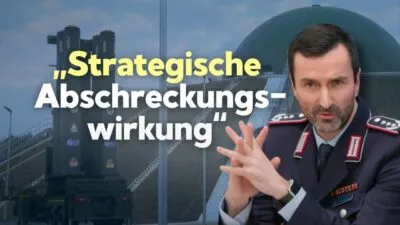Kontroverse vor laufenden Kameras
Trump stellt Ramaphosa zur Rede: Gewalt gegen weiße Farmer spaltet Südafrika
Bei einem kurzfristig anberaumten Besuch im Weißen Haus sah sich Südafrikas Präsident Ramaphosa scharfer Kritik durch Donald Trump ausgesetzt. Im Fokus: Gewaltverbrechen gegen weiße Farmer, umstrittene Enteignungsgesetze und Südafrikas außenpolitische Kehrtwende – insbesondere die Annäherung an den Iran und Angriffe auf Israel.

Trump macht seinem Besuch im Oval Office schwere Vorwürfe.
Foto: Evan Vucci/AP/dpa
Am Mittwoch, 21. Mai, hatte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus besucht. Wie Trump erläuterte, sei das Treffen kurzfristig zustande gekommen – auf Initiative des ANC-Politikers. Ramaphosa erklärte am Ende des vertraulichen Teils davon, dass dieses „sehr gut“ verlaufen sei. Zuvor sah er sich jedoch im öffentlichen Teil unter Rechtfertigungsdruck. Seine US-Gastgeber hatten ihn mit organisierten Übergriffen und Hassrhetorik gegen weiße Farmer in Südafrika konfrontiert.
Ramaphosa bestreitet Musk-Narrativ von „weißem Genozid“
Vor allem auf Initiative von US-Milliardär und Regierungsberater Elon Musk hatte die US-Regierung ein Aufnahmeprogramm für weiße Farmerfamilien aus Südafrika ins Leben gerufen. Bis dato haben 60 Personen davon Gebrauch gemacht. Musk hatte zuvor von einem „Genozid an Weißen“ gesprochen, der in seinem Geburtsland Südafrika stattfinde.
In Südafrika stellen weiße Nachfahren europäischer Siedler, die seit Mitte des 17. Jahrhunderts ins Land gekommen waren, etwa zehn Prozent der Bevölkerung. Zugleich stehen zwei Drittel des Farmlands im Land im Eigentum weißer Farmer. Ein Gesetz aus dem Jahr 2018 hat Enteignungen zum Zwecke der Umverteilung erleichtert. Dies weckte bei Betroffenen Argwohn – immerhin hatte es im benachbarten Simbabwe ab der Jahrhundertwende ähnliche Entwicklungen gegeben.
Gleichzeitig kommt es Jahr für Jahr zu mehreren Dutzend Überfällen organisierter Banden auf Farmen – die häufig mit brutalen Morden an deren Eigentümern enden. Als Ramaphosa bestritt, dass es systematische Kampagnen gegen weiße Farmer in Südafrika gäbe, ließ Trump ein Video abspielen.
Gewaltkriminalität in Südafrika „tatsächlich ein ernstes Problem“
Dieses zeigte unter anderem den Führer der sogenannten Economic Freedom Fighters (EFF), Julius Malema, dessen Rhetorik für Übergriffe gegen Farmer mitverantwortlich gemacht wird. Dazu waren in dem Video Aufnahmen von Grabstätten und Trauergästen bei Beerdigungen ermordeter Landeigentümer zu sehen. Trump warf Ramaphosa vor, dass die Täter unbehelligt blieben und die südafrikanische Regierung nicht gegen die Banden vorgehe.
Ramaphosa erklärte daraufhin, die Fälle nicht zu kennen. Er betonte, dass Südafrika eine Mehrparteiendemokratie sei, in der jeder sich äußern könne. Auch sei es nicht erlaubt, einfach Land an sich zu nehmen. Als Trump noch einmal unterstrich, dass Überfälle auf Farmen und Morde an deren Besitzern ungeahndet blieben, räumte Ramaphosa ein, dass Gewaltkriminalität in seinem Land tatsächlich ein ernsthaftes Problem sei.
Allerdings wies der südafrikanische Präsident den Vorwurf zurück, dass diese das Ausmaß eines „weißen Genozids“ annehme. Die meisten Opfer von Gewaltverbrechen seien auch in Südafrika Schwarze. Ramaphosa stellte auch einflussreiche weiße Gäste vor. Unter ihnen waren der Unternehmer Johann Rupert und die Golfspieler Erenie Els und Retief Goosen.
Ramaphosa band sogar burische Autonomisten in sein Kabinett ein
Landwirtschaftsminister John Steenhuisen, der als Mitglied der oppositionellen Demokratischen Partei dem Kabinett angehört, erklärte, dass Farmüberfälle und Viehdiebstähle ein großer Grund zur Sorge seien. Er arbeite mit Polizei und Justiz zusammen, um diese zur Priorität zu machen. Bezogen auf Julius Malema und andere Extremisten äußerte Steenhuisen, er arbeite mit Ramaphosas Partei zusammen, um „diese Leute von der Macht fernzuhalten“.
Die Economic Freedom Fighters (EFF) hatten bei den Parlamentswahlen im Vorjahr 9,5 Prozent und 39 von 400 Parlamentssitzen erlangt. Damit mussten sie gegenüber 2019 Einbußen hinnehmen. Allerdings hatten ihr Umfragen im Vorfeld ein deutlich höheres Ergebnis vorhergesagt. Ihr schwaches Ergebnis geht vor allem darauf zurück, dass der wegen Korruptions- und Vergewaltigungsvorwürfen vom ANC verstoßene Ex-Präsident Jacob Zuma eine eigene Liste aufgestellt hatte. Diese kam auf 14,6 Prozent und 58 Sitze.
Der seit dem Ende der Apartheid regierende ANC hatte im Vorjahr erstmals seine absolute Mehrheit verloren. Ramaphosa bildete nach den Wahlen eine Koalition mit der größten Oppositionspartei, der Demokratischen Allianz. Mit der Inkatha Freedom Party (IFP) aus der Zulu-Volksgruppe und der vor allem von Coloureds (Mischlingen) gewählten rechtsgerichteten Patriotic Alliance (PA) gehören auch zwei identitätspolitisch ausgerichtete Parteien dem Kabinett an. Seit Juni 2024 ist auch die „Vryheidsfront +“, die für einen Buren-Volksstaat eintritt, mit Pieter Groenewald als Minister für Strafvollzug im Kabinett vertreten.
Paramilitärs und Banden profitieren von Überforderung der Polizei
Die Sicherheitslage in Südafrika wird nach wie vor vielerorts als prekär wahrgenommen. Die regulären Sicherheitskräfte zeigen sich in vielen Fällen als überfordert. Häufig bilden sich paramilitärische Gruppen und Banden, die sich entlang ethnischer und sozialer Linien formieren.
In Kapstadt hat sich etwa die muslimische Bürgerwehr „Pagad“ gebildet, die vorwiegend die Nachkommen malaiischer Einwanderer unter ihrem Banner vereint. Sie geht unter anderem militant gegen Drogenbosse in ihren Townships vor und soll 400.000 Mitglieder haben. Da sie präsent ist, wo die Polizei wenig ausrichten kann, genießt sie auch Sympathien innerhalb der weißen Bevölkerung.
Gleichzeitig gibt es eine Vielzahl kriminell ausgerichteter Banden, die für eine hohe Gewalt- und Mordrate verantwortlich sind. Häufig rekrutieren sie bereits Kinder ab zehn Jahren aus den Townships. In ländlichen Gebieten bestehen nach wie vor auch bewaffnete und vielfach politisch extrem rechts ausgerichtete weiße Paramilitärs wie die „Suidlanders“. In der Provinz KwaZulu-Natal unterhält auch die Inkatha Freedom Party (IFP) noch bewaffnete Vereinigungen.
Die Economic Freedom Fighters (EFF) stehen Erkenntnissen der Sicherheitskräfte zufolge nicht selbst unter Waffen und eine direkte Beteiligung an Farmüberfällen konnte ihnen bislang nicht nachgewiesen werden. Allerdings stimmten Mitglieder und Funktionäre auf Kundgebungen Hassgesänge gegen Buren und Farmer an, die aus der Apartheid-Zeit stammen. Dies und ihre Rhetorik werden vielfach als Aufruf zur Gewalt interpretiert. Die meisten Farmüberfälle haben Kriminologen zufolge jedoch einen allgemein kriminellen und keinen politischen Hintergrund.
Kritik der USA an Südafrika auch durch außenpolitische Weichenstellungen bedingt
Die Beziehungen zwischen den USA und Südafrika, deren Verbesserung der Besuch von Ramaphosa dienen sollte, sind noch durch weitere Faktoren belastet. In einer Verordnung vom 7. Februar setzte US-Präsident Donald Trump jegliche Hilfszahlungen an Südafrika aus. Neben der Farmerproblematik sprachen auch weitere Gründe für den Schritt.
So laufe auch die Außenpolitik des Landes elementaren US-Interessen zuwider. Südafrika lege eine „aggressive Position“ gegenüber den USA und deren Verbündeten an den Tag. So habe das Land den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) gegen Israel eingeschaltet. Zudem habe Südafrika seine wirtschaftlichen und militärischen Verbindungen zum Iran wiederbelebt – sogar im Bereich der Atomkraft.
Am 5. Februar hatte US-Außenminister Marco Rubio deshalb auch angekündigt, nicht am für November geplanten G20-Gipfel in Johannesburg teilnehmen zu wollen. Auf X erklärte er, Südafrika „tut viele schlechte Dinge“. Das Land enteigne privates Land und nutze die G20 für politische Agenden wie die ESG-Ziele. Rubio hält es für wenig sinnvoll, den Gipfel zu besuchen. Er schrieb:
„Meine Aufgabe ist es, Amerikas nationale Interessen zu fördern, nicht Steuergelder zu verschwenden oder Antiamerikanismus zu verhätscheln.“
Reinhard Werner schreibt für Epoch Times zu Wirtschaft, gesellschaftlichen Dynamiken und geopolitischen Fragen. Schwerpunkte liegen dabei auf internationalen Beziehungen, Migration und den ökonomischen Folgen politischer Entscheidungen.
Aktuelle Artikel des Autors
5. Dezember 2025
Schulstreik gegen neuen Wehrdienst: Proteste in über 50 Städten
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.