
Die letzte Chance des Adalbert Brenner
Adalbert Brenner ist Schlossermeister und Inhaber einer kleinen Schlosserei in einem kleinen Ort im südlichen Deutschland. Eigentlich lebt Adalbert Brenner sehr genügsam. Und weil er selbst nicht viel zum Leben braucht, gesteht er anderen noch weniger zu. Auch seine neue Frau Hedwig, die dritte schon, hält sich mit nutzlosen Ausgaben zurück, arbeitet hart und weiß es ihm auch sonst recht zu machen. Sie ist ganz anders als seine zweite Frau, die von ähnlichem Naturell war wie er selbst: zielstrebig, raffgierig und so geizig, dass sie sich eher die Fingernägel abbiss, als einem Bettler auch nur eine winzige Münze zu geben. Oft stritten sie und suchten, sich in ihrer Knauserigkeit zu übertreffen. Am Ende starb Mechthild jämmerlich im Fieberbett, weil sie zu geizig war, einen Doktor kommen zu lassen. Stattdessen schickte sie Adalbert zur Apotheke, Medikamente zu holen. Doch dieser war wiederum so geizig, dass er statt der Medikamente nur einen einfachen Kräutertee zur Stärkung mitbrachte. Aus Zorn darüber hörte das zänkische Weib auf zu atmen. Doch das ist lange her…
Heute, am Abend vor Weihnachten zieht Adalbert gutgelaunt durch die verschneiten Straßen der kleinen Stadt. Gerade heute hatte er einen lukrativen Auftrag für seine Schlosserei bekommen und, wohl der eigentliche Grund seiner hämischen Freude, er hatte seinem fleißigen und gewissenhaften Gesellen Anton Zeisig das wohlverdiente Weihnachtsgeld gestrichen, aus wirtschaftlichen Gründen, hatte er gesagt.
Mit solchen und anderen Gedanken beschäftigt schleicht Adalbert an den mit weißen Schneegirlanden und bunten Lichterketten geschmückten Verkaufshütten auf dem Marktplatz vorbei. Von irgendwo her erklingt weihnachtliche Glöckchenmusik. Da! Aus einer der Hütten wandern schwere dampfende Glühweinschwaden heraus, um sich mit den leichten Düften gebrannter Mandeln und Maronen vom Nachbarstand zum Tanze zu treffen. Inmitten des fröhlichen Reigens jedoch, da stehen ein paar Menschen um einen runden Stehtisch herum, schwatzend, schlürfend und knabbernd. Nicht weit von ihnen knackt ein wärmendes Holzfeuer, in eisernem Feuerkorb gezügelt, und wirft Asche und kleine helle Funken hoch in die Luft, die sich mit ihrem würzigen Kiefernduft wirbelnd davonmachen. Von oben jedoch und ungeachtet des Treibens, schweben einige Schneeflocken herab, nicht wild, eher sanft und beschaulich … „Kommerzscheiß!“, flucht Adalbert, als er mit hartem, wertendem Blick der vorweihnachtlichen Szenerie gewahr wird. „Bah! Trinker und Tagediebe, als wenn es nichts zu schaffen gäbe!“ Kurz blicken die Leute zu ihm hinüber, in manchem der Gesichter spiegelt sich Ärger wider. „Blödmann!“, blafft ein junger Mann zurück. Eine ältere Dame schüttelt verständnislos den Kopf. Adalbert Brenner stapft, schon deutlich schlechter gelaunt, weiter. Nach ein paar Schritten schnappt er sich unbemerkt von einem Stand ein Stück Weihnachtsgebäck und beißt hinein: „Bah! Gut, dass ich das nicht gekauft habe, viel zu trocken.“
Noch mit dem Gebäck beschäftigt, hört er plötzlich einen leisen, bibbernden Gesang, von einer klirrenden Gitarre begleitet, der es mindestens genauso kalt zu sein scheint, wie dem Barden selbst: „Knock, Knock, knocking on heavens door…“ Er schaut sich um, dann sieht er ihn, den alten Straßenmusiker, in der Kälte stehend und seine Hoffnung zum Himmel singend. „Da, hier hast du was zum Beißen! Zu Weihnachten!“ Adalbert lacht, als er dem alten Mann sein angebissenes Gebäckstück in den mit kleinen Geldstücken besprenkelten dunklen Grund des Gitarrenkoffers wirft. Der Musikant beachtet ihn nicht, singt einfach weiter: „Mama put my guns in the ground, I can’t shoot them any more …“ Adalbert schaut fragend drein. „Immer dieses verdammte Ausländisch.” Verärgert geht er weiter.
{R:2}
„Entschuldigen Sie! Darf ich Ihnen …“. Adalbert stoppt die alte Dame abrupt, die ihm ein Faltblatt hinhält. „Was soll das! Ich kaufe nichts!“ „Ich wollte doch nur…“, entgegnete die in eine dicke Jacke eingewickelte Frau erschrocken. „Es geht um Menschenrechte … in China … die Falun Gong-Übenden … die werden dort grausam gefoltert …“ Adalbert knurrt sie an: „Bah! China, weit weg, was geht das mich an? Alles Ausländer! Mir geht’s selber schlecht.“ „Aber man muss doch was tun … sich … informieren!“ Dann schaut sie auf den Schnee vor ihren Füßen: „Wir können doch nicht immer wegschauen!“, verzweifelt sie. „Ich schon!“, brummt Adalbert mürrisch: „Frag doch den lieben Gott, ob er hilft. Lass mich in Ruhe damit! Ich hab selber Sorgen: meine Angestellten fressen mein Geld, arbeiten schlecht und die Kundschaft ist fern – vielleicht in China. Hahaha.“ Adalbert lacht über seinen eigenen Witz. Dann lässt er die alte Dame in der Kälte stehen und stapft davon. Traurig schaut sie ihm nach, kopfschüttelnd; vielleicht tut er ihr leid, der Adalbert. Langsam verschwindet der hartherzige Mann hinter den dichter werdenden Schneeflocken, auf dem Weg in sein warmes Heim.
„Die Mechthild!“ Adalbert Brenner fährt wie vom Blitz getroffen hoch. Kalter Schweiß steht ihm auf der Stirn, seine eisigen Hände und Füße zittern unter der dicken warmen Daunendecke. Er spürt hastigen flachen Herzschlag in seiner Brust, in seinem Hals, in seinen Schläfen. Mit weit aufgerissenen Augen starrt er an die Wand im Halbdunkel vor sich, auf der sich bedächtig winkende dürre Fingern hin und her bewegen. „Die Mechthild!“, entfährt es ihm wieder. „Sie…“, stammelt er verstört, den Rest wagt er nicht mehr auszusprechen. Nur das volle Mondlicht, verstärkt vom Schnee der letzten Tage leuchtet kühl durch das kleine Fenster und wirft sanft wogende Schatten von Ästen und Zweigen ins Zimmer, als Ehefrau Hedwig, vom nächtlichen Geschrei aufgeweckt, die Nachttischlampe anknipst. „Was ist passiert“, fragt die jäh aus dem Schlaf Gerissene. Erschrocken blickt sie zu Adalbert, dessen starrer Blick immer noch, seinem ausgestreckten Arm und Zeigefinger folgend, auf der Wand verharrt. „Adalbert!“ Sie setzt sich auf und rüttelt am Ärmel seines blau und weiß karierten Baumwollschlafanzuges. Adalbert wendet ihr langsam den Kopf zu. „Ich … ich hab’ die Mechthild gesehen!“ „Ach, was redest du da, die Mechthild ist doch tot!“ Hedwig zieht sich schaudernd die Decke bis übers Kinn hoch. „Sie hing in Ketten, sah furchtbar aus, ich meine, noch schlimmer als zu Lebzeiten … Sie … sie sagte, ich müsse mich ändern … solange ich noch am Leben sei. Sie beschwor mich: ‚Adalbert’, sagte sie, ‚für mich ist es zu spät, aber du, du hast noch die Chance, dein böses Leben zu ändern. Lass ab von deinem Geiz, der Gier nach Geld und deiner Hartherzigkeit. … Hörst du nicht die wilden Schreie der Häscher der Hölle, die mit glühenden Eisen hinter mir her sind. Sieh dir die eisernen Ketten an, die mich schwer zu Boden reißen… Durch die ewige Dunkelheit schleppe ich mich, mühsam kriechend und voll unerträglicher Angst, auf der endlosen Flucht vor den Häschern. Jeder Schritt schmerzt unendlich und ist doch noch erträglicher als die glühenden Eisen, die mich brennen, wenn ich vor Erschöpfung verschnaufe. Adalbert! Um deinetwillen, ich flehe dich an, kehre um auf deinem eingeschlagenen Weg.’ Dann fing sie an zu zittern und sich ängstlich umzuschauen. ‚Ich muss fort,’, sagte sie noch, ‚sie sind schon nahe … Adalbert! Drei Geister werden dich besuchen, dir eine letzte Warnung sein … drei G e i s t e r!’ Ihre letzten Worte verhallten in der Dunkelheit, in der sie verschwand. Dann sah ich in der Ferne einen roten Glutschein, der ihr zu folgen schien.“ Die Hedwig versucht ihn zu beschwichtigen: „Nur ein böser Traum, Adalbert, alles wird gut. Du hattest zuviel von dem guten Wein.“ Adalbert sackt ins Kissen zurück und murmelt vor sich hin: „Vielleicht hast du recht, nur ein böser Traum.“ Bald darauf schläft er ein.
Wom! „Überraschung!“ Die Ohrfeige hat gesessen, Adalbert wacht auf. Erschrocken blickt er auf den Knaben mit dem runzelig alten Gesicht, der nur mit Nachthemd bekleidet auf seinem Bauch sitzt. Dong! Die kleine Hand klatscht auf Adalberts Stirn. „Was willst du, hässlicher Gnom?“ Adalbert versucht ihn abzuschütteln, doch sein Körper reagiert nicht. „Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht. Wir beide, wir werden etwas Spaß haben. Komm mit!“, fordert der Geist ihn auf und springt von seinem Bauch. Dann schwebt er zum Fenster, dreht sich zu Adalbert um und fordert ihn wieder auf: „Komm mit!“ Adalbert will nicht, aber das scheint nicht von Bedeutung zu sein. Schon schwebt er in der Luft. Noch einmal dreht er sich um, zu seinem Bett, und schaut … auf den schlafenden Adalbert, der mit offenem Mund neben der schnarchenden Hedwig liegt. „Bin ich tot?“, fragt er erschrocken den knabenhaft wirkenden Geist. „Noch nicht!“, antwortet dieser und lächelt ihn bedeutungsvoll an. Dann greift er Adalbert fest beim Handgelenk, fängt hell und irre an zu lachen und schon sausen beide durch das geschlossene Fenster in die Nacht hinein.
Über Berge und Täler geht die Reise, Landschaften und Städte fliegen an ihnen vorbei, sie rasen durch Nacht und Tag, Winter und Sommer, Frühling und Herbst, schneller und schneller werdend. Dann, plötzlich, halten sie an. Sie schweben vor einem tristen Häuschen. Vor dem Nachbarhaus steht ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum; nicht aber vor diesem Haus, das Adalbert seltsam bekannt vorkommt. „Da habe ich als Kind gewohnt!“, spricht er mit aufgeregter Stimme. Dann senkt sich sein Blick, seine Augen fangen an zu glitzern, nur einen Augenblick lang. „Ich weiß schon“, stammelt er und schluckt, „ich hatte neue Handschuhe bekommen, für die Feldarbeit… Nicht, dass ich nicht dankbar gewesen wäre, aber … ich hätte so gerne ein Spielzeug gehabt, ein klitzekleines nur. Ich hätte mich so gefreut.“ Traurig blickt Adalbert zu Boden. „Aber Vater, er meinte, es solle ein sinnvolles Geschenk sein. Die Handschuhe würden mir bei der Arbeit helfen und ich solle dankbar sein. Ich solle bescheiden sein, so wolle es der liebe Gott. Ich hab’ die halbe Nacht nicht geschlafen und nur weinend aus dem Fenster zum Mond hinauf geschaut. Irgendwann kamen keine Tränen mehr, dann hab’ ich mich gefragt, ob der liebe Gott das wirklich so will.“ Behutsam nimmt der Geist Adalbert bei der Hand. Leise spricht er: „Ich weiß … Du warst ein gutes Kind. Doch komm! Wir müssen weiter.“ Nur eine Sekunde später waren sie angekommen: Weihnachten, ein fröhliches Fest im neuen Heim. Seht den Adalbert, wie er ausgelassen mit seiner jungen Frau tanzt. Sie haben gerade zusammen ihre Schlosserei eröffnet, das Geld ist knapp, die Arbeit hart, aber sie sind voller Zuversicht und Liebe. Ein Ringlein schenkt er ihr, nicht teuer, aber von Herzen. Die Gudrun, so heißt seine erste Frau, sie lacht und schenkt ihm ein kleines Kästchen, winzig klein. Er öffnet es und schaut auf einen kleinen Zettel, auf dem steht: „Geh raus! Schau dich um!“ Als er dann vor die Tür tritt, sieht er erst nichts Auffallendes. Dann dreht er sich um, will wieder ins Haus, da sieht er es, das hölzerne Schild, kunstvoll mit bronzefarbenen Buchstaben bemalt: ‚Schlosserei Adalbert Brenner’. Die Gudrun jauchzt und freut sich, Adalbert blickt mit feuchten Augen auf das erste Firmenschild seines Werkstattladens. Sanft nimmt er seine Frau in die Arme und drückt sie fest an sich. „Danke“, haucht er ihr ins Ohr und sie flüstert zurück: „Auch danke!“
„Weißt du noch“, flüstert der Geist Adalbert ins Ohr, „wie hart ihr gearbeitet hattet? Aber das reichte dir nicht. Bald schon hattest du angefangen Liebe und Glück gegen Geld einzutauschen. Die Geschäfte liefen immer besser. Du hattest einiges Geld am Finanzamt vorbei geschafft, zu Hause gehortet. Die Gudrun hatte es dann versteckt, aus Angst, und auch für schlechte Zeiten. Da hattest du sie aus dem Haus geworfen, mit Nichts, sie würde dich bestehlen, hattest du gebrüllt. Du Narr! Nach der Scheidung kam die Mechthild, nicht unverdient, möchte ich meinen.“ Adalbert schwitzt, fühlt sich unwohl, möchte weglaufen, seine Beine schwingen durch, auf der Eisplatte unter seinen Füßen. Wums! Krachend landet er auf seinem Rücken und klopft auch noch den Boden mit dem Hinterkopf. Mit einem Schrei wacht Adalbert durchgeschwitzt neben Hedwig auf, die im Halbschlaf stöhnt: „Nicht schon wieder!“ Adalbert sinkt verstört ins Kissen zurück und von dort aus wieder in tiefen Schlaf.
Schon schrickt Adalbert wieder auf, Sekunden später nur, wie ihm scheint. Ein eisiger Windhauch hat ihn aus dem Schlaf gerissen. Vor seinen übermüdeten Augen zeigt sich eine wohlgenährte, weihnachtlich festlich gekleidete Gestalt. „Ich bin der Geist der diesjährigen Weihnacht“, sagt sie lächelnd und ganz nahe kommend fährt sie fort: „Pst! Pass auf! Ich habe dir etwas zu zeigen!“ Dicker weißer, nach Vanille duftender Nebel umfängt Adalbert und die Gestalt. Als der Nebel sich auflöst, stehen beide in einem einfach eingerichteten Wohnzimmer. Ein kleiner Tannenbaum steht festlich geschmückt in der Mitte des kleinen Raumes, in dem es merkwürdig still ist. Neben dem grünen Bäumchen sitzt ein junges Ehepaar auf einem kleinen alten Sofa von ockerfarbenem, abgegriffenem Stoff. Sie halten sich bei den Händen, die Frau hat ihren Kopf auf die Schultern des Mannes gelegt, der zum Weihnachtsbaum starrt. „Anton!“, ruft Adalbert seinem Gesellen zu. Doch niemand reagiert. „Das sind doch Anton und Jasmin Zeisig!“, fährt Anton dem Geist zugewandt fort. „Sie können dich nicht hören … und auch nicht sehen!“, erklärt ihm sein unheimlicher Begleiter. „Warum sitzen die denn so still da?“, fragt Adalbert kleinlaut, „und wo ist eigentlich …“. Weiter kommt er nicht. „Der Timmy …“, der Geist seufzt: „ … der Timmy, der ist tot!“ „Antons kleiner Junge?“ Adalbert schluckt, aber der Kloß sitzt fest in seinem Hals. „Wann?“, fragt er mit zitternder Stimme. „Er war schon immer etwas kränklich, die Wohnung feucht und kalt. Schon im Sommer wollte sich die kleine Familie eine andere Wohnung suchen, vergeblich. Nicht so einfach, bei dem bisschen Geld, was Anton bei dir verdient. Der Kleine hustete schon eine ganze Weile, bekam schlecht Luft. Dann, vor zwei Tagen, lag er einfach tot in seinem kleinen Bettchen.“ „Wie schrecklich“, jammert Adalbert und eine dicke Träne löst sich aus den sonst so harten Augen und noch eine und noch eine. Warm läuft es Adalberts Gesicht hinab, tropft vom Kinn auf das harte Herz, erwärmt es. Unter Tränen erzählt er: „Ich hatte ihn nur einmal gesehen. Der Anton brachte ihn einmal ins Geschäft mit. Ich war nicht sehr freundlich zu Anton, schalt ihn, was denn ein Baby im Geschäft solle. Auch den Kleinen guckte ich grimmig an. Aber er, der Timmy, der lächelte mich einfach an. Verstehst du? Ich guck ihn grimmig an und er, er lächelt nur. Das hat noch niemand mit mir gemacht.“
„Was ist los mit dir und warum schwitzt du so?“, fragt Hedwig, den Adalbert verdutzt anschauend. „Ach … es ist nichts.“ Erschöpft sinkt Adalbert wieder in sein Kissen. Auch Hedwig legt sich wieder hin und denkt noch bei sich: ‚Was für eine merkwürdige Nacht.“ Kurz darauf schnarchen beide friedlich. Dann erwacht Adalbert wieder, diesmal ohne ersichtlichen Grund. Er schaut in die Dunkelheit vor sich, in der bewegungslos ein dunkler Schatten steht. Als er näher kommt, erkennt Adalbert die Umrisse einer unheimlichen Gestalt, gehüllt in einen langen schwarzen Umhang. Obwohl der Fremde kein Sterbenswörtchen sagt, ahnt Adalbert, dass es der dritte Geist, der Geist der zukünftigen Weihnacht sein muss. Schweigend deutet die Gestalt mit ihrem Knochenfinger zum Fenster. Adalbert weiß, was jetzt kommt. Etwas zieht ihn unaufhaltsam aus dem Bett. Kurz darauf gleiten beide durch die grauen Straßen der Stadt. Es muss früher Abend sein, die Menschen eilen nach Hause, immer weniger sind auf der Straße zu sehen. Bei einer Gruppe von Leuten verharren die Reisenden einen Augenblick. Das Gespräch handelt von einem alten, geizigen Mann, der gestorben sei. Niemand wirkt besonders traurig. „Recht ist ihm geschehen“, poltert ein dicker Herr und verabschiedet sich aus der Gruppe. Adalbert und der Geist streifen weiter durch die dunkler werdenden Gassen in ein düsteres Viertel, stadtbekannt für seine eigentümlichen Bewohner und Geschäftigkeiten. Durch das Fenster einer heruntergekommenen Kneipe sieht er, wie ein paar Gestalten an einem langen Tisch einige Werkzeuge und Gerätschaften aufteilen. Adalbert denkt noch bei sich: ‚Komisch, solche Werkzeuge habe ich auch in meiner Werkstatt.’ Doch schon geht es weiter und dunkler und düsterer wird der Weg, der hinaus zum Stadtrand führt. Keine Laterne begleitet sie jetzt mehr, kein Laut ist zu hören. Das Mondlicht wirft entstellte Schatten von Bäumen in den Schnee und auf die Reste der alten Stadtmauer, die nur wenige Meter weiter im Dunkel der hereinbrechenden Nacht verschwindet. Krah, krah, durchbricht ein heiserer Rabe, der irgendwo in den Ästen der alten Eiche zu sitzen scheint, die Totenstille. Und vor ihnen zeigt sich die Silhouette des schmiedeeisernen Friedhofstores, das sich knarrend vor ihnen öffnet und den Blick auf das schauerliche Gräberfeld freigibt. Der Geist schwebt den kleinen Friedhofsweg hinab, dicht gefolgt von Adalbert, der sein Gesicht mit den Händen bedeckt und sich nur zwischen den Fingern hindurchzugucken getraut. Krah, krah, krächzt der Rabe wieder, ihnen mit flatterndem Flügelschlag folgend. Vorbei geht es an verwitterten Grabsteinen und verwilderten Gräbern, vorbei an den unheimlichen Grüften der wenigen reichen Familien der Stadt. Wieder krächzt der Rabe, diesmal nahe hinter Adalbert, doch dieser wagt es nicht, sich umzudrehen, denn sein Blick starrt wie gebannt auf ein frisches Grab: Keine Blumen, kein Kranz, nichts, nur frisch aufgeworfene Erde und ein kalter Marmorstein deuten auf den kürzlich Verstorbenen hin. Mit Entsetzen liest Adalbert die frische Inschrift: Adalbert Brenner – am Geiz erstickt – gestorben am Weihnachtsabend. Adalbert merkt kaum noch, wie ihm die Knie wegsacken und er auf das Grab stürzt. Kühle Erde umfängt sein Gesicht. Dann wacht er auf; in seinem Bett.
Es ist Weihnachtsmorgen. Adalbert schaut vorsichtig über den Rand seiner Bettzipfel, dann springt er aus dem Bett, gutgelaunt. „Ich lebe!“, schreit er laut und freut sich, dass die letzte Nacht vorbei ist. „Ihr da im Himmel! Ich will mich ändern!“, ruft er geläutert und mit guten Vorsätzen versehen. Die Hedwig wacht auf und schaut ihn aus verquollenen Augen, den Zeugen der Nacht, fragend an. „Ich bin ein anderer Mensch, meine Liebe, wie neugeboren!“ Kaum kann er es erwarten, die erste gute Tat zu tun. So schnell war er noch nie in seinen Kleidern und auf und davon. Zuerst geht er bei seinem Gesellen Anton vorbei, der ihm verschlafen auf sein Klingeln öffnet. „Der Chef!“, schrickt er zusammen, als er den unvermuteten Besucher erkennt. „Schschöne Wweihnachten, Chef!“ „Seit wann stotterst du denn? Naja, dir auch schöne Weihnachten und deiner Familie auch“, antwortet Adalbert dem verdutzt dreinblickenden Menschen. Jasmin Zeisig kommt, vom Lärm angelockt, zur Tür, um zu sehen, was denn da so früh am Morgen los sei. In ihren Armen hält sie … den kleinen Timmy. „Du lebst ja!“, freut sich Adalbert und strahlt den Kleinen an, der ihn zurücklächelnd anbrabbelt: „Addi gaddi dada.“ „Und wie schön er schon sprechen kann!“, scherzt Adalbert und fährt, zu Anton gewandt, fort: „Ich wollte dir sagen, dass ich dein Gehalt ab sofort erhöhe, wegen deiner Treue und Zuverlässigkeit. Und hier, hier ist dein Weihnachtsgeld.“ Mit diesen Worten überreicht Adalbert dem Anton einen Umschlag. „Und den kleinen Timmy immer schön warm halten, damit er sich nicht erkältet“, gibt er der Familie noch wohlwollend mit auf den Weg. Dann ist er verschwunden. In der Stadt grüßt er freundlich die Menschen, die trotz der morgendlichen Stunde schon auf dem Weihnachtsmarkt verweilen. Auch der Straßenmusiker ist schon bei der Arbeit und singt John Lennons „Happy Christmas (War Is Over)“. Adalbert lauscht eine Weile der Musik und, obwohl er wieder nichts verstanden hat, wirft er einen Geldschein in den noch leeren Gitarrenkoffer. Diesmal erntet er ein vertrautes Augenzwinkern. ‚Komisch, die wissen wohl alle, was sich letzte Nacht zugetragen hat’, denkt Adalbert noch bei sich und hält Ausschau. Aber er kann sie nicht finden, die alte Dame vom Vorabend, die für die Rechte fremder Menschen in der Ferne eintrat. Es tut ihm aufrichtig leid, dass er so herzlos war, und er schickt eine stille Bitte in den morgendlichen Himmel, dass der liebe Gott den Menschen im fernen China helfen möge, ihr Leben in Freiheit zu führen.
Gerade will er sich auf den Heimweg machen, als ihn ein kleiner Tannzapfen auf den Kopf fällt. Er schaut sich um, kann aber niemanden entdecken.
{L:3}
Da fällt es ihm ein: ‚Oh Mann, die Hedwig! Ich habe noch gar kein Geschenk für sie. Was mag sie eigentlich?“ Entsetzt stellt er fest, dass er eigentlich gar nichts von seiner Frau weiß. Er überlegt und überlegt, dann geht er in den Juwelierladen, der zufällig wenige Schritte weiter neu eröffnet hat. Schnell hat er ein nettes Ding gefunden, ein Kettchen, feingliedrig, golden und mit einer kleinen weißen Perle als Anhänger, recht schlicht gehalten und doch von Anmut. Zuhause angekommen, umarmt er seine Hedwig, steckt ihr das kleine Etui zu und wünscht ihr schöne Weihnachten. Da soll man doch nicht sagen, dass es keine Wunder mehr gibt.






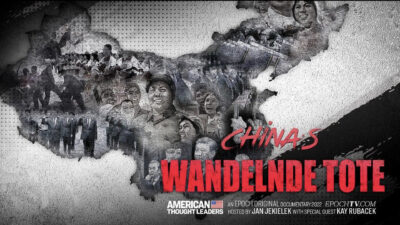

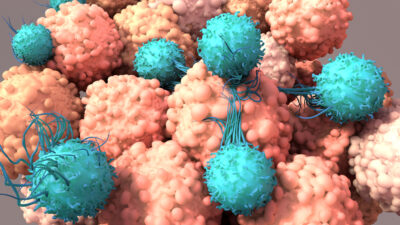








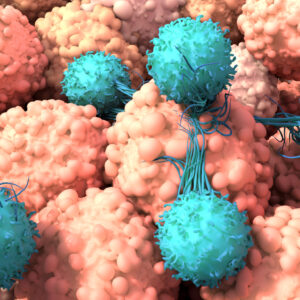











vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion