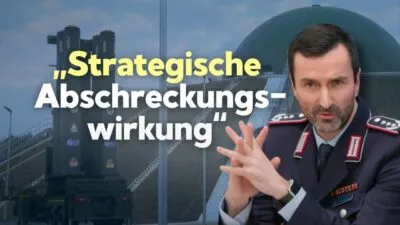Grundrechte nur noch Nebensache?
Ex-„Süddeutsche“-Chef Prantl: „Ich habe Angst um unsere Grundrechte“
Der langjährige Politikchef der „Süddeutschen Zeitung“, Heribert Prantl, hat in einem Interview mit der „Berliner Zeitung“ tiefe Besorgnis über Einschränkungen von Grundrechten in Corona-Zeiten zum Ausdruck gebracht. Er sieht die Gesundheit der Demokratie in Gefahr.

Süddeutsche Zeitung.
Foto: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Im März wird das Buch „Not und Gebot: Grundrechte in Quarantäne“ des langjährigen Politikchefs und ehemaligen Mitglieds der Chefredaktion in der „Süddeutschen Zeitung“, Heribert Prantl, erscheinen.
Darin wird sich der bis dato eher als Wortführer im linksliberalen Spektrum geltende Prantl mit den Grundrechten in Krisenzeiten am Beispiel der Corona-Pandemie befassen.
Grundrechte in der Corona-Krise nur noch Nebensache?
Diese sieht der bekannte Journalist in Gefahr. „Ich habe Angst um unsere Grundrechte“, bekennt er im Gespräch mit der „Berliner Zeitung“. Deren Wesen sei es, dass sie gerade in einer Krise gelten müssten. Es sei „fatal zu glauben, man könne sie ja eine Zeit lang geringer leuchten lassen“, allerdings erscheine ihm diese Haltung aktuell als die dominante.
Prantl pflichtet dem langjährigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, bei, der sich nach eigener Aussage nie hätte vorstellen können, dass die Exekutive in Deutschland in die Lage kommen würde, derartig weitreichende Freiheitsbeschränkungen in Geltung zu setzen.
Der frühere Süddeutsche-Chef beklagt eine einseitige Dominanz von Naturwissenschaftlern und Virologen in der Politik:
„Die Regierung muss Verfassungsrechtler, Pädagogen, Soziologen, Ökonomen und Kinderärzte anhören. Die Grundrechte sind kein Larifari. In einem demokratischen Rechtsstaat steckt die Kraft der Hoffnung in den Grundrechten – auch und gerade in Krisenzeiten.“
„Temporäre“ Einschränkungen sind zu häufig dauerhaft geworden
Prantl dämpft zudem Hoffnungen, wonach ein Ende der Corona-Pandemie eine zeitnahe Rückkehr zur Normalität zur Folge hätte, insbesondere auch mit Blick auf die Grundrechte.
Zu häufig habe man die Erfahrung machen müssen, dass Einschränkungen der Grundrechte, die als anlassbezogene, vorübergehende Maßnahmen dargestellt worden seien, bis heute weitergegolten haben.
So sei der RAF-Terror zwar Geschichte, damals eingeführte Maßnahmen, die in das Post- und Fernmeldegeheimnis und die Unverletzlichkeit der Wohnung eingegriffen hätten, seien jedoch bis heute Teil des Strafprozessrechts. Ebenso die Kronzeugenregelung.
Ähnliche Erfahrungen mit „zeitlich befristeten“ Gesetzen, die aber immer wieder verlängert wurden, habe man auch nach 9/11 gemacht. Dass „Einschränkungen zur Normalität“ werden könnten, befürchtet Prantl auch jetzt:
„Die Einschränkungen können auch als Blaupause verwendet werden, für das nächste Virus, für den nächsten Katastrophenfall. Doch das Grundgesetz steht nicht unter Pandemievorbehalt.“
„Es gibt das Grundrecht, sich seinen Lebensunterhalt frei verdienen zu können“
Es gäbe Einschränkungen der Grundrechte wie die Maskenpflicht – diese sei „zwar unbequem, aber kann und muss toleriert werden“.
Schwerwiegender würde das Ganze jedoch, wo der Staat sich anmaße, zu bestimmen, wer sich mit wie vielen Menschen treffen dürfe, oder dort, wo es um die Existenz von Menschen gehe, wie bei den Einschränkungen der Gewerbefreiheit.
„Es gibt das Grundrecht, mit anderen Menschen Kontakt zu pflegen“, betont Prantl. „Das ist die Basis für Demokratie. Es gibt das Grundrecht, sich frei zu bewegen. Es gibt das Grundrecht, sich seinen Lebensunterhalt frei verdienen zu können.
Das ist nicht ein Recht, möglichst viel Geld zu verdienen. Es ist das Recht, sich selbst um seine Existenz sorgen zu können. Die Maßnahmen jetzt werden die Existenzen von hunderttausenden Menschen zerstören.“
Beamten, die über ein gesichertes Einkommen verfügen, würde diesbezüglich die Sensibilität fehlen.
Auch Menschenwürde und Recht auf Bildung seien zu beachten
Der langjährige „Süddeutsche“-Chef fordert von der Politik, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Auge zu behalten. Das Grundgesetz sehe keinen Wettbewerb um härtestmögliche Maßnahmen vor, sondern Differenzierung.
Nicht jedes Mittel sei geeignet und angemessen, um Leben und Gesundheit zu schützen, auch die Würde des Menschen sei zu beachten. Dies gelte beispielsweise mit Blick auf alte Menschen, die einsam in Pflegeheimen stürben.
Auch das Recht der Kinder auf Bildung dürfe nicht außer Acht gelassen werden. Prantl befürchtet eine Verschärfung der sozialen Ungleichheit im Bildungswesen als Resultat der Lockdown-Maßnahmen. Ärmere und bildungsferne Milieus würden zu den Hauptleidtragenden gehören. Es müsse zwar Vorsichtsmaßnahmen geben, aber auch ein „Grundrecht auf Schule“.
Prantl sieht auch Mitschuld an der Entwicklung bei den Medien
Neben den konkreten Einschränkungen der Grundrechte bereitet auch der gesellschaftliche Diskurs Prantl Sorgen. Dass eine im Grundgesetz nicht vorgesehene Bund-Länder-Runde die entscheidenden Weichen stelle und die Parlamente sich aus ihrer Verantwortung entfernten, entspreche nicht der Demokratie, wie sie die Verfassung vorsieht.
Zudem mache sich eine Art „Corona-Fundamentalismus“ breit, der die Debatte und die Atmosphäre vergifte und selbst Zwischentöne in die Nähe der „Corona-Leugnung“ rücke. Der „politische Selbstlockdown der Parlamente“ habe bedenkliche Entwicklungen gefördert.
Auch bei den Medien sieht Prantl eine Mitschuld an der Entwicklung:
„Die Medien haben zu Beginn der Krise als Frühwarnsystem gut funktioniert. Dann sind sie zu sehr zu einem Dauerwarnsystem geworden. Wir müssen die Maßnahmen und die Alternativen diskutieren. Wir sind nicht dafür da, die Alternativlosigkeit nachzubeten. Es darf keinen autoritären Weg geben, wie über Lösungen entschieden wird.“
Journalisten sollten sich wieder stärker als Wächter der Grundrechte in Stellung bringen.
Reinhard Werner schreibt für Epoch Times zu Wirtschaft, gesellschaftlichen Dynamiken und geopolitischen Fragen. Schwerpunkte liegen dabei auf internationalen Beziehungen, Migration und den ökonomischen Folgen politischer Entscheidungen.
Aktuelle Artikel des Autors
7. Dezember 2025
Tübingen: Geburtstagsgruß ruft Datenschützer auf den Plan
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.