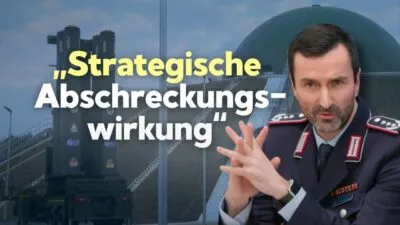Analyse
CDU in Erklärungsnot: Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber Linken spaltet die Partei
Die Debatte um eine mögliche Abänderung des Unabhängigkeitsbeschlusses gegenüber der Linkspartei belastet die CDU. Vor allem in ostdeutschen Bundesländern bringen neue Realitäten die Partei in die Zwickmühle. Gleichzeitig sorgt eine Antisemitismus-Debatte für Verunsicherung.

In Thüringen sind Linkspartei und CDU bereits seit 2020 für bestimmte Beschlüsse aufeinander angewiesen.
Foto: Martin Schutt/dpa
In der CDU überschattet die Debatte um den seit 2018 bestehenden offiziellen Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der Linkspartei den Start in die Koalition. Am Dienstag, 6. Mai, hatte man mit der Linken im Bundestag paktiert, um einen zweiten Wahlgang zur Wahl des Bundeskanzlers zu ermöglichen. Dies hatten bereits Teile der Partei als eine Infragestellung der politischen Abgrenzung bewertet.
Der Parteitag der Linken am vergangenen Wochenende in Chemnitz hat nun für zusätzliche Brisanz gesorgt. Dieser hatte sich der sogenannten Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus (JDA) angeschlossen und diese zur begrifflichen Grundlage für ein Eintreten gegen Judenhass erhoben.
Damit hat der Parteitag jedoch gleichzeitig der Arbeitsdefinition Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) eine Absage erteilt. Diese gilt in Deutschland unter anderem für staatliche Hoheitsträger, aber auch für jüdische Verbände als relevant.
CDU hatte gegenüber der Linken-Vorgängerpartei PDS keinen Unvereinbarkeitsbeschluss
Die CDU hatte ihre „Brandmauer“-Politik seit der Wiedervereinigung mehrfach modifiziert. Im Juli 1989 äußerte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl gegenüber dem ZDF, die CDU schließe eine politische Zusammenarbeit mit „Radikalen“ aus. Dies gelte „für die Kommunisten ebenso wie für die Grünen und für die Republikaner ebenso wie für die NPD“.
Mit der Wiedervereinigung erfuhr das Parteiensystem eine tiefgreifende Änderung. Die aus der DDR-Staatspartei SED heraus gegründete Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) schaffte aufgrund ihres Zuspruchs in den neuen Bundesländern den Einzug in den gesamtdeutschen Bundestag. Auf Länderebene und in zahlreichen Kommunen konnte die Partei in Ostdeutschland zweistellige Ergebnisse erzielen.
Zwischen der CDU und der PDS gab es in den Jahren nach Wiedervereinigung keinen formalen Unvereinbarkeitsbeschluss. Faktisch war er auch nicht nötig. Beide Parteien sprachen komplett entgegengesetzte Zielgruppen an – die Union die Gewinner der Einheit, die PDS deren Verlierer.
Union und SPD waren zumeist stark genug, um auch ohne Einbindung der SED-Nachfolger Mehrheiten zu organisieren. In Bayern fand aufseiten der CSU eine Debatte um den Umgang mit der PDS nie statt, weil diese im Freistaat politisch keine Rolle spielte.
SPD betrieb seit 1994 Politik der Einbindung der PDS
Die SPD brach jedoch 1994 erstmals das Tabu einer Annäherung an die PDS. In Sachsen-Anhalt ließ Ministerpräsident Reinhard Höppner seine rot-grüne Landesregierung durch diese tolerieren. Vier Jahre später ging Harald Ringstorff in Mecklenburg-Vorpommern sogar die erste rot-rote Regierungskoalition ein.
Die Union versuchte in Wahlkämpfen mit der Warnung vor rot-rot-grünen Bündnissen Punkte zu sammeln. Der Erfolg war uneinheitlich. Noch bis weit in die 2000er-Jahre hinein gelang es CDU und CSU, auf Bundesebene und in westdeutschen Bundesländern Wähler zu binden.
In Ostdeutschland wurde die kommunal stark verankerte PDS jedoch eher als pragmatisch und als „normale“ Partei wahrgenommen. Deshalb hatten gezielt gegen die Sozialisten geführte Wahlkämpfe dort tendenziell geringeren Erfolg.
Im Jahr 2005 begann ein Umwandlungsprozess der PDS. Sie hatte erst mit der westdeutschen Anti-Hartz-IV-Partei WASG ein Wahlbündnis geschlossen. Zwei Jahre später vollzogen die neuen Partner den formalen Zusammenschluss zur Partei „Die Linke“.
Dieser gelang in weiterer Folge nicht nur eine Verankerung in vielen westdeutschen Landesparlamenten, auch im Bundestag war sie in Fraktionsstärke vertreten. In den 2000er-Jahren kamen weitere Regierungsbeteiligungen in Berlin und Brandenburg dazu, im Jahr 2014 stellte die Linke erstmals einen Ministerpräsidenten.
Schwarz-Grün und „Jamaika“ galten lange als Wählerschreck
Die CDU öffnete sich gegen Ende der 2000er-Jahre gegenüber Koalitionen mit den Grünen. Im Jahr 2008 kam es in Hamburg zur ersten schwarz-grünen Regierungszusammenarbeit auf Landesebene unter Ole van Beust. Ein Jahr später bildete Peter Müller im Saarland das erste „Jamaika“-Bündnis.
Bei den Wählern kam die Öffnung der Union zu den Grünen zu Beginn nicht gut an. In Hamburg holte Olaf Scholz 2011 die absolute Mehrheit, im Saarland bildete Annegret Kramp-Karrenbauer eine Große Koalition.
In NRW erlebte die CDU unter dem als möglicher Ministerpräsident für Schwarz-Grün geltenden Norbert Röttgen 2012 bei den Landtagswahlen ein Fiasko. Die schwarz-grüne Koalition in Hessen 2013 war das erste Regierungsprojekt dieser Art, das seine Mehrheit verteidigen konnte.
Dennoch wollte sich die Union fortan Bündnisse mit den Grünen als potenzielle Machtoption erhalten. Die SPD hatte mit diesen und der Linken, aber auch möglichen Ampel-Koalitionen wie in Rheinland-Pfalz mehrere Machtoptionen.
Die Union hingegen drohte ihren Bündnispartner FDP einzubüßen, der 2013 erstmals aus dem Bundestag gewählt wurde. Gleichzeitig erlebte mit der AfD eine Partei am rechten Rand einen flächendeckenden Aufstieg, mit der man vonseiten der CDU und CSU ebenfalls nicht koalieren wollte.
Wahlen 2026 könnten Union vor harten Entscheidungen stellen
Da eine einseitige Abgrenzung von der AfD vor allem in konservativen Parteikreisen und ostdeutschen Landesverbänden Kritik auslöste, fällte der CDU-Bundesparteitag 2018 einen doppelten Unvereinbarkeitsbeschluss. In diesem hieß es:
„Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab.“
Die Ereignisse rund um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen im Februar 2020 hatten zur Konsequenz, dass die CDU diesen Beschluss noch einmal unterstrich. Allerdings war das rot-rot-grüne Minderheitenkabinett unter Bodo Ramelow bei der Ministerpräsidentenwahl und Haushaltsbeschlüssen auf Mitwirkung der Union angewiesen. Die Landtagswahlen 2024 haben CDU-Ministerpräsident Mario Voigt vor ähnliche Sachzwänge gestellt.
Jüngste Umfragen zeigen, dass die CDU bereits im nächsten Jahr vor noch komplizierteren Verhältnissen stehen könnte. In Sachsen-Anhalt deutet das Zweitstimmenergebnis bei der Bundestagswahl an, dass eine Regierung ohne die AfD nur um den Preis einer Beteiligung von Linkspartei und BSW möglich sein könnte. Ähnlich könnte es in Mecklenburg-Vorpommern ausgehen.
CDU koaliert in Thüringen bereits mit BSW
Während Kanzleramtsminister Thorsten Frei eine Überprüfung der Lockerung des Beschlusses für diskutabel hält, sieht Generalsekretär Carsten Linnemann diesbezüglich keinen Spielraum. Dies gelte erst recht angesichts des Antisemitismus-Beschlusses der Linken vom Wochenende.
Dieser wurde auch vom Zentralratspräsident Josef Schuster kritisiert:
„Die Ignoranz der Linkspartei gegenüber der jüdischen Gemeinschaft, in der die IHRA-Definition weltweit anerkannt ist, zeigt einen radikalen Kern der Partei, der – getrieben von Israelhass – dazu beiträgt, den Antisemitismus unserer Zeit zu verschweigen.“
Anders als die IHRA-Arbeitsdefinition, die Delegitimierung, Dämonisierung und doppelte Maßstäbe mit Bezug auf Israel klar als antisemitisch benennt, erwähnt die „Jerusalemer Erklärung“ de facto den Staat Israel nicht. „Israelkritik“ soll nach dieser Auffassung im Kern nur noch dann antisemitisch sein, wenn diese mit essentialistischen Zuschreibungen an Juden oder darauf gestützten Verschwörungstheorien verbunden ist.
Die Erklärung, die laut den Autoren „klare Leitlinien zur Erkennung und Bekämpfung von Antisemitismus bei gleichzeitigem Schutz der Meinungsfreiheit“ geben soll, besagt:
„Antisemitismus ist Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden (oder jüdische Einrichtungen als jüdische).“
Linken-Parteichef Jan van Aken erwiderte auf die Kritik von Josef Schuster der Deutschen Presse-Agentur (dpa): „Der Zentralrat sollte anerkennen, dass beide Definitionen auch von Jüdinnen und Juden erarbeitet und vertreten werden. Das Problem an der IHRA-Definition ist unter anderem, dass sie eine kritische Auseinandersetzung mit dem Staat Israel und somit seiner Regierung nahezu verunmöglicht. Diese Auseinandersetzung muss es jedoch gerade in Zeiten dieses brutalen Krieges in Gaza geben dürfen.“
Musiker und ex-Parteimitglied der Linken, Andrej Hermlin, äußerte hingegen mit Blick auf den Beschluss des Linken-Parteitages:
„Israelhass ist an diesem Wochenende von einer Mehrheit der Delegierten des Parteitags legitimiert worden.“
Parteichef Jan van Aken stellt es gegenüber der dpa so dar: „Beim Schutz von Jüdinnen und Juden, sowohl hier als auch in Israel, gibt es kein Vertun. Das Existenzrecht Israels bleibt auch weiterhin unangefochten Teil unserer DNA.“ Eine Kritik am Handeln Israels müsse aber erlaubt sein.
Ob der Beschluss der Linken jedoch taugt, um eine Lockerung des Unvereinbarkeitsbeschlusses der CDU gegenüber der Linkspartei zu vereiteln, ist ungewiss. In Thüringen koaliert die CDU mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Dieses war die einzige Partei, die im Vorjahr im Bundestag gegen eine Resolution zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland gestimmt hatte, die auf die IHRA-Definition gestützt war.
Reinhard Werner schreibt für Epoch Times zu Wirtschaft, gesellschaftlichen Dynamiken und geopolitischen Fragen. Schwerpunkte liegen dabei auf internationalen Beziehungen, Migration und den ökonomischen Folgen politischer Entscheidungen.
Aktuelle Artikel des Autors
7. Dezember 2025
Tübingen: Geburtstagsgruß ruft Datenschützer auf den Plan
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.