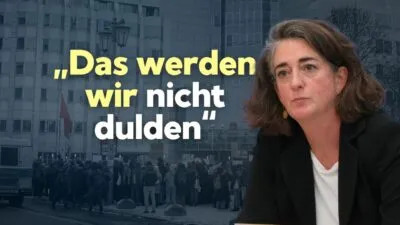Corona und der Sozialstaat: Kurzfristig wird Arbeitslosigkeit teurer, langfristig die Rente
Die Corona-Krise wird auch die systemischen Probleme der Sozialversicherung weiter verschärfen. Kurzfristig ist es vor allem die Arbeitslosenversicherung, die für Kurzarbeit und ALG I tief in die Tasche greifen muss, langfristig wird die Rente deutlich teurer.

Wird der deutsche Sozialstaat langfristig zusammenbrechen?
Foto: istock
Die Höhe der Sozialausgaben in Deutschland wird im Jahr 2021 insgesamt 926 Milliarden Euro erreichen. Dies berichtet die „Welt“ unter Berufung auf ein Sondergutachten der fünf Wirtschaftsweisen. Gegenüber dem Jahr 2019 wäre das ein Plus von 80 Milliarden Euro. Was die Situation weiter verschärft, ist, dass der Corona-bedingte Konjunkturabsturz Einnahmen wegbrechen lässt.
Von 2,5 Milliarden Euro Einnahmenüberschuss auf Zehn-Milliarden-Defizit in vier Monaten
Dies führt dazu, dass nicht nur die Reserven, mit denen die Sozialversicherungen ins Jahr 2020 gestartet waren, angetastet werden müssen, sondern auch dazu, dass der Bund mit zusätzlichen umfangreichen Zuwendungen zu rechnen hat, auf die er in Anspruch genommen wird. Dies könnte allein schon aufgrund der Tatsache unumgänglich sein, dass die Bundesregierung in ihrem jüngsten umfassenden Corona-Hilfspaket auch eine „Sozialgarantie“ verankert und damit einen Anstieg der Sozialbeiträge auf mehr als 40 Prozent ausgeschlossen hat.
Bereits jetzt weist das Statistische Bundesamt für das erste Jahresdrittel eine dramatische Entwicklung im Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Sozialversicherungsträger aus. Aus einem 2,5-Milliarden-Überschuss an Einnahmen, mit dem die Anstalten insgesamt ins Jahr 2020 gegangen waren, wurde bis Ende April ein Minus von mehr als 9,7 Milliarden. Ein Ende der Fahnenstange ist nicht abzusehen, da auch der Mai noch weitgehend vom Lockdown gekennzeichnet war und die Rückkehr zu mehr Normalität im Wirtschaftsleben noch im Juni verhältnismäßig schleppend vonstattenging.
Löhne noch lange nicht zurück auf Stand vor Corona-Krise
Ein wesentlicher Faktor der Entwicklung war der drastische Anstieg an Leistungen aus der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung – wie Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld I. Im April waren sieben Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit, im darauffolgenden Mai immer noch sechs. Bundesagentur-Chef Detlef Scheele rechnet allein mit Blick auf das Kurzarbeitergeld mit Gesamtkosten von 30 Milliarden Euro. Die Agentur verfügt über angesparte Mittel von 26 Milliarden Euro.
Das Missverhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben werde bis auf Weiteres anhalten, schätzt Arbeitsmarktexperte Alfred Boss vom Institut für Weltwirtschaft im Gespräch mit der „Welt“. Eine Zunahme der Lohnsumme wie in den vergangenen Jahren werde es 2020 nicht geben. Stattdessen werde die Zahl der Beschäftigten auch bis auf Weiteres nicht den Stand von vor der Corona-Krise erreichen und die Verdienstsummen würden ebenfalls niedriger bleiben. Boss rechnet mit einem Minus von zwei Prozent bei der Lohnsumme.
Krankenkassen droht Liquiditätsengpass
Da es bereits nach der Weltfinanzkrise von 2008/09 mehr als zwei Jahre gedauert hatte, bis der Arbeitsmarkt wieder die Struktur der Vorkrisenära aufwies, ist damit zu rechnen, dass der Spielraum der Bundesagentur noch längere Zeit deutlich geringer bleiben und die Höhe der Bundeszuschüsse weiterhin anwachsen wird. Immerhin hat die Koalition in ihrem jüngsten Hilfspaket die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld auf bis zu zwei Jahren ausgeweitet.
Im Bereich der Krankenversicherung hat die Corona-Krise zwar trotz Massentests und zusätzlicher Intensivbetten zu einem Rückgang des Kostenaufwandes geführt, weil zahlreiche Betten nicht belegt waren und Behandlungen verschoben wurden. Allerdings werden die Einsparungen vielfach durch Mehrausgaben aufgewogen, die etwa aus 2019 beschlossenen zusätzlichen Pflegestellen und Mindestsprechstundenzeiten resultieren. Zudem ist ungewiss, wie sich die Beiträge bis zum Ende des Jahres entwickeln werden und wie viele Krankenkassen mit den zugewiesenen Mitteln aus dem Gesundheitsfonds das Auslangen finden werden. Gelingt dies nicht flächendeckend, droht ein Liquiditätsengpass.
Langfristig wird Rente zum Kostentreiber im Sozialstaat
Vor allem in der Pflegeversicherung, wo die Leistungen ausgeweitet wurden, aber nun Einnahmen wegbrechen, droht das vorzeitige Ende des erst 2015 im Zuge der Pflegereform eingeführten Vorsorgefonds. Dieser sollte bis 2035 Kapital ansparen, um den drohenden Beitragsdruck abzufedern. Nun ist zu befürchten, dass er herhalten muss, um Corona-bedingte Budgetlöcher zu stopfen.
Einzig die gesetzliche Rentenversicherung kann sich bis auf Weiteres noch über Stabilität freuen. Sie wird aber perspektivisch mit einer Kostenexplosion zu rechnen haben.
Die Altersbezüge sind mit 1. Juli sogar um 3,45 Prozent im Westen und um 4,2 Prozent im Osten angestiegen. Obwohl die Renten der Lohnentwicklung des Vorjahres folgen, müssen die Bezieher dank einer gesetzlichen Garantieklausel aber auch in den kommenden Jahren keine Einbußen fürchten. Zudem hat Sozialminister Hubertus Heil 2018 durchgesetzt, dass es anders als früher auch in weiterer Folge keine Anpassung nach unten infolge eines Nachholfaktors geben wird.
Bundeszuschuss wird deutlich höher ausfallen
Die Folge: Rentner nehmen Lohnerhöhungen mit, werden aber von der Anpassung an stagnierende oder sinkende Löhne abgeschirmt. Dies geht derzeit auf Kosten der Beitragszahler, deren Beitragssatz derzeit bei 18,6 Prozent liegt und immerhin infolge der Sozialgarantie bis 2025 maximal bis 20 Prozent anwachsen kann. Was darüber hinausgeht, muss der Bund aus dem Haushalt zuschießen: Derzeit sind das fast 100 Milliarden Euro. In den kommenden Jahren könnte sich die Summe infolge des „Corona-Lochs“ noch deutlich erhöhen.
Aktuelle Artikel des Autors
12. Dezember 2025
Neues Etikett, ähnlicher Inhalt? Streit um Heizungsgesetz
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.