
Erste deutsch-britische Stromtrasse: Habeck beim Spatenstich dabei

Eine unterseeische Stromtrasse soll künftig die Stromnetze von Großbritannien und Deutschland verbinden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist dafür am Montag zum Spatenstich nach Wilhelmshaven. Der Energiefachmann Harald Bradke vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) erhofft sich durch die neue Stromverbindung Entlastungen für Verbraucher.
„Diese Interkonnektoren ermöglichen den Stromaustausch zwischen den Stromnetzen in Europa und erhöhen damit den Wettbewerb und die Versorgungssicherheit“, erklärte Bradke.
Bis die innerdeutschen Stromtrassen von Norden nach Süden fertig ausgebaut sind, werde durch die neue Leitung auch deutscher Windkraftstrom nach Großbritannien fließen. Das entlaste die deutschen Stromkunden, denn derzeit müssen Anlagen bei einem hohen Windstromangebot an den deutschen Küsten abgeregelt werden.
Deutschland entwickelt sich zum Strom-Importland
Längerfristig geht der VDI-Experte davon aus, dass große Windparks vor Schottland günstigen Strom nach Deutschland liefern werden.
„Aufgrund des schleppenden Ausbaus der Stromerzeugung aus Windenergie bei uns, ist zu erwarten, dass sich Deutschland zumindest mittelfristig von einem Strom-Exportland zu einem Strom-Importland entwickeln wird, wie es bereits 2023 der Fall war.“
Deutschlands Stromnetz ist bereits seit Jahren mit denen seiner Nachbarn verbunden. Bis 2022 erwirtschafteten die Stromerzeuger so einen Exportüberschuss.
2023 wurde erstmals mehr importiert als exportiert. Dazu beigetragen hatte das Abschalten der letzten deutschen Atomkraftwerke, vor allem war es aber ein Preisfrage: Besonders im Norden Europas sei viel günstiger Windstrom produziert worden, erklärte Bradke. Deshalb seien „die teureren fossilen deutschen Kraftwerke nicht benötigt“ worden. (afp)









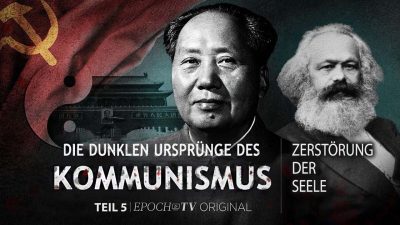
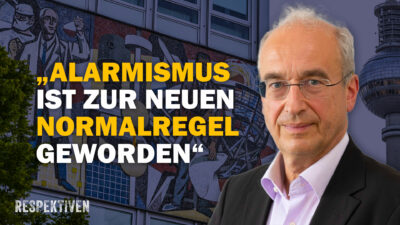























vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion