
Nun heißt es also „Eine-Welt“ – Eigeninteressen sind nicht mehr erlaubt

Es scheint sich um eine historische Gesetzmäßigkeit zu handeln. In dem gleichen Maße, wie der Gottesglaube sinkt, steigt der Glaube an politische Götter. In der westlichen Welt erreicht das Bekenntnis zum Christentum immer neue Tiefstände.
Doch gemäß dem Energieerhaltungssatz verschwinden die im Menschen angelegten Sehnsüchte nicht, sie verändern sich. Jetzt richtet sich der Glaube an die eigene Moral und statt Gott steht die „Eine-Menschheit“ im Mittelpunkt.
Es ist kein Zufall, dass die Moralisierungen des woken Denkens an den Universitäten der USA begannen. Für die Studenten – meist aus reichem Haus – dient es als eine Art Ablasshandel für ihre Privilegien.
Indem sie ihre Werte gleich auf die ganze Welt ausdehnen wollen, erheben sie einen Wahrheitsanspruch, der zumal von deutschen Gesinnungseiferern umgehend übernommen wurde. Vor dem Horizont der „Einen-Welt“ sind Eigeninteressen nicht länger statthaft und werden als nazistisch oder rassistisch diffamiert.
Bußgelder der reicheren Staaten gefordert
Dieses selbstverleugnende globale Denken droht, lokale Interessen zu ruinieren. Ein Beispiel sind die Migrationsströme, die durch offene Grenzen und falsche Anreize über uns hereinbrechen. Zu kritisieren sind nicht die Menschen, die kommen, sondern diejenigen, die dies durch falsche Anreize und mangelnde Kontrolle provozieren und ermöglichen.
Bei der Ausbreitung des Coronavirus von einer chinesischen Epidemie zur Pandemie wurden weitere Schattenseiten der mutwilligen Entgrenzungen offenkundig. Aktuelle Engpässe am Medikamentenmarkt entlarven den Globalismus selbst als ökonomische Utopie.
Mit dem Krieg in der Ukraine und dem folgenden Sanktionskrieg des Westens gegen Russland ist die „Eine-Welt“ vollends an der Realität zerschellt, woraus sich die undiplomatische Wut erklärt, „Russland ruinieren“ (Annalena Baerbock) zu wollen. Auch die „feministische Außenpolitik“ wird etwa in Afghanistan nicht umarmt. Die 200 Millionen Euro, die Ministerin Baerbock zur Frauenförderung an die Taliban überwies, wurden angenommen und die Schulen und Hochschulen für Frauen geschlossen.
Die „Global Governance“ endet in Pakten mit sich selbst in einem weltweiten Migrations-, Klima- und Biodiversitätspakt. Wer sich an die Vereinbarungen hält, erleidet Konkurrenznachteile. Wichtig sind den Staaten des „Globalen Südens“ Bußgelder der reicheren Staaten. Der Globalismus des Westens wird in anderen Kulturen nicht ernst genommen, sondern ausgenutzt.
Die Globalisierung wird weitergehen – der Globalismus nicht
Das Gesetz der Kostenvorteile im Freihandel wird auch in Zukunft Geltung behalten. Über die Grenzen, was dem Wettbewerb ausgesetzt werden soll und was nicht, müsste aber im Lichte lokaler und nationaler Interessen gestritten werden.
Bei den immerzu als „Rechts“ geschmähten Kräften handelt es sich in Wirklichkeit um Protektionisten, die das Eigene schützen wollen. Je stärker diese Kräfte ins Abseits gedrängt werden, desto stärker drohen sie sich zu extremisieren. Stattdessen müsste sie in neuen Diskursen über lokale Mittelwege zwischen Globalismus und Protektionismus eingebunden werden.
Die großen Konflikte der Gegenwart handeln nicht mehr zwischen Links und Rechts, sondern zwischen Globalisten und Protektionisten. Letztere fordern etwa eine Dezentralisierung der Grundversorgung an Medikamenten oder auch Nahrung und mehr Protektion für mittelständische Existenzen. Die Suche nach lokalen Mittelwegen ist die politische Aufgabe der Zukunft.
Der Aufbau kontrollfähiger europäischer Grenzen wäre die wichtigste Voraussetzung für mehr Schutz des Eigenen. Jenseits von utopischem Globalismus und regressivem Nationalismus wäre die Koexistenz der Kulturen und großen Mächte anzustreben. Die Europäer müssen entscheiden, ob sie selbst eine Macht oder nur ein Objekt sein wollen.
Rekonstruktion der bürgerlichen Gesellschaft
Der zwar berechtigte, aber unzureichende Zorn von Wutbürgern droht ohne jeden Gottesbezug und eigenen positiven Erzählungen zu scheitern. Sowohl Trump als auch die Brexiter reagierten nur auf Teilprobleme der Globalisierung und blieben ihr damit verhaftet. Eine neue Kulturrevolution dürfte sich nicht primär an der Wiederherstellung der Vergangenheit orientieren („Take back Control“; „Make America Great Again“).
Sie würde die besseren Elemente der Vergangenheit für eine Neugestaltung der Zukunft nutzen. Auf die christlichen Weisheiten über die Natur des Menschen, der benediktinischen Regeln und der christlichen Soziallehre kann der einst „Abendland“ genannte Westen nicht verzichten. Im Christentum hat die Trennung von geistigen und weltlichen Kategorien den Keim für die Freiheit etwa von Wissenschaft und Wirtschaft gelegt. Mit den Grenzen des Christentums werden zugleich die Grenzen des Westens und seiner Selbstbehauptung deutlich.
Unsere Kultur ist in ihrem Wesenskern durch gegenseitige Ergänzungen von ideellen und materiellen, kulturellen und zivilisatorischen Kräften gekennzeichnet. Diese Ergänzungen beginnen im Ideal der Bürgerlichkeit mit ihrem spezifischen Ausgleich von Rechten und Pflichten.
Aber es geht auch um die Wiederannäherung der unterschiedlichen bürgerlichen Ideologien. Die Einsicht in die Notwendigkeit einer Selbstbegrenzung könnte dabei helfen. Sofern etwa dänische Sozialdemokraten den Sozialstaat und liberale Aktivisten individuelle Freiheitsrechte vor der Scharia schützen, würden linke und rechte, liberale und konservative Kräfte wieder zusammenrücken.
Und schließlich kann die ungeheure Komplexität der globalen Prozesse nicht von einem Weltgehirn bewältigt werden. Gefordert ist vielmehr eine umfassende Dezentralisierung – angefangen beim Wiederaufbau familiärer Lebensformen, der sich fortsetzt beim größeren Schutz regionaler, nationaler und europäischer Wirtschaftsräume. Vor allem aber ginge es statt um Selbstverleugnung und Selbsthass, um die Anerkennung der eigenen Interessen und den Respekt vor der eigenen Kultur.
Über den Autor:
Heinz Theisen ist Professor für Politikwissenschaft und Autor, zuletzt erschien sein Buch „Selbstbehauptung“. Er lehrte als Gastdozent auch in Osteuropa und im Nahen Osten, darunter in Bethlehem und Jordanien.
In seinem neuen Buch „Selbstbehauptung: Warum Europa und der Westen sich begrenzen müssen“ beschreibt der Politikwissenschaftler eine multipolare Welt, in der Kulturen und Mächte koexistieren und eine Strategie der Eindämmung gegenüber feindseligem Totalitarismus verfolgen.
Olzog edition im Lau Verlag, Reinbek. Weitere Informationen unter www.lau-verlag.de/titel/selbstbehauptung/
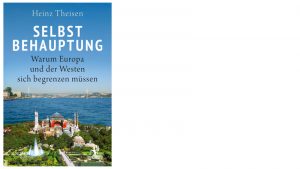
Unsere Buchempfehlung
Moderne Pädagogik konzentriert sich nicht auf die Vermittlung der moralischen Standards, der Kultur und des Wissens der Menschheit, wie allgemein vermutet. Ihr Ziel ist die „Erziehung und Bildung als Therapie“: Gefühle und Einstellungen der Schüler sollen bestimmten politischen Vorgaben entsprechen.
Der Ökonom Thomas Sowell analysierte, dass heutiger Unterricht zur Vermittlung der Werte die gleichen Maßnahmen verwendet, die in totalitären Ländern zur Gehirnwäsche von Menschen im Einsatz sind. Dazu zählt, emotionalen Stress hervorzurufen, "um sowohl den intellektuellen als auch den emotionalen Widerstand zu brechen".
Ein anderes Mittel ist die Isolation der Kinder (ob physisch oder emotional) von vertrauten Quellen emotionaler Unterstützung. Sie stehen stetig im Kreuzverhör und müssen ihre Werte darlegen - oft unter Manipulation des Gruppenzwangs.
Normale Abwehrmaßnahmen wie "Reserviertheit, Würde, ein Gefühl der Privatsphäre oder die Möglichkeit, die Teilnahme abzulehnen" werden unterbunden. Die erwünschten Einstellungen, Werte und Überzeugungen hingegen massiv belohnt.
Das Kapitel 12 des Buches "Wie der Teufel die Welt beherrscht" untersucht die Sabotage an der Bildung. Es heißt: "Das Bildungswesen sabotieren: Wie Studenten zu dummen Radikalen umerzogen werden". Hier mehr zum Buch.
Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop
Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.
Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.
Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]




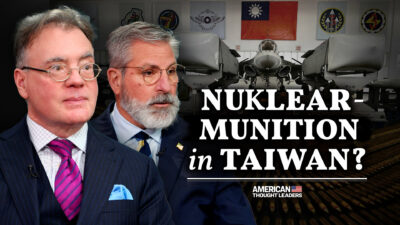

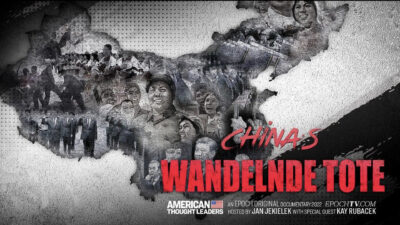






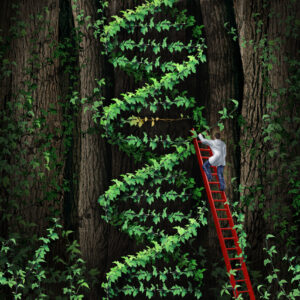















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion