
Weltbank rechnet mit bis zu 200 Millionen „Klimaflüchtlingen“ – Begriff bleibt umstritten

SVR sucht Wege für „Klimaflüchtlinge“ nach Europa
Einen Tag, bevor Bund und Länder im Rahmen des Flüchtlingsgipfels zäh über Wege verhandelten, die gegenwärtigen Betreuungspflichten zu finanzieren, blickte man beim SVR schon weiter. Die Folgen des Klimawandels seien, so der Konsens, mit den derzeitigen Instrumenten des deutschen Asylrechts nicht zu bewältigen. Es bedürfe anderer, neuer Instrumente, um sogenannten Klimaflüchtlingen einen Weg nach Europa zu eröffnen. Wie das ZDF berichtet, fielen Begriffe wie Klimapass oder Klimacard, und Betroffene sollten auch ein Klima-Aufenthaltsrecht erhalten. Der Klimapass solle dabei ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht verbriefen. Dieses soll unter anderem für Menschen gelten, deren Inselstaat im Meer versunken sei. Bis dato gibt es diesbezüglich nur Modellrechnungen.
Forscher zweifeln an Akzeptanz in der Bevölkerung
Die Klimacard wiederum solle Klimaflüchtlingen offenstehen, die aufgrund der Folgen von Naturkatastrophen vorübergehend ihre Heimat verlassen müssten. Für weniger stark vom Klimawandel betroffene Personen solle es ein Klima-Arbeitsvisum geben können. Die Voraussetzung dafür solle ein fester Arbeitsvertrag sein. Der globale Norden sei nach Auffassung der SVR-Berater hauptverantwortlich für den menschengemachten Beitrag zum Klimawandel. Daher treffe ihn eine höhere Verantwortung. Allerdings äußerten die Forscher auch Zweifel bezüglich der Akzeptanz eines solchen Konzepts in der Bevölkerung. Während die Bereitschaft, von Krieg betroffene Menschen aufzunehmen, hoch sei, sei es fraglich, ob dies auch der Fall sei, wenn der Fluchtgrund der Klimawandel sei.
Flüchtlingsorganisationen und potenziell Betroffene lehnen Begriff „Klimaflüchtling“ ab
Unumstritten ist der Begriff des „Klimaflüchtlings“ nicht – Kritik kommt unter anderem von Flüchtlingsorganisationen selbst. Davina Wadley von „Refugees International“ erläutert, dass Flüchtlinge per definitionem von ihren Regierungen verfolgt würden oder vor Kriegszuständen fliehen, in die sie häufig involviert seien. Demgegenüber würden sich die Regierungen potenziell betroffener Länder sehr engagiert für den Schutz ihrer Bürger vor Klimafolgen engagieren. Außerdem habe der Westen ein komplett falsches Bild von der Situation. Dort ginge man davon aus, dass die meisten Menschen, die infolge von Klimaveränderungen ihre Heimat verließen, nach Europa oder Nordamerika kämen. In den häufigsten Fällen seien jedoch die ärmsten Bevölkerungsteile am stärksten von Naturkatastrophen und ihren Folgen betroffen. Diese hätten jedoch gar nicht die Ressourcen, um an einen weit entfernten Ort zu fliehen.
„Klimamigration“ als moderne imperiale Erzählung der Europäer?
Der Geograf W. Andrew Baldwin aus Durban vermutet hinter dem Begriff des „Klimaflüchtlings“ sogar ein imperiales Konstrukt der Europäer. In einem Beitrag für „The Conversation“ bezieht er sich dabei auf den Literaturwissenschaftler Edward Said. Dieser sah in seinem Buch „Orientalismus“ das Konzept des „Anderen“ als Vorwand für Europäer, Nichteuropäern deren eigene Geschichte zu verweigern. Der Orientalismus sei keine Form des Wissens gewesen, die einfach die Realität des Lebens im Orient dokumentiert hätte. Vielmehr habe dieser die europäische imperiale Macht legitimiert, indem er die Nichteuropäer als „Teil der Natur“ und nicht als vollwertige Menschen angesehen hätte:
Es erlaubte Europa, zu glauben, dass es die moralische Pflicht hatte, in das Leben der anderen einzugreifen; die anderen zu modernisieren, indem es sie in den Schoß der Geschichte holte.“
Heute würde ähnliches auf Begriffe wie „Klimamigrant“ oder „Klimaflüchtling“ zutreffen. Man verwende diese Kategorien, um eine große Anzahl von Menschen „über das Klima und nicht über die Geschichte zu definieren“. Dies mache die Geschichte von Orten zweitrangig gegenüber dem Klimawandel. In weiterer Folge untergrabe dies das Recht der Menschen, sich selbst zu ihren eigenen Bedingungen darzustellen.



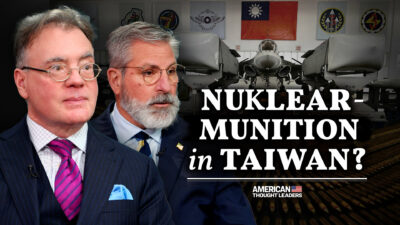

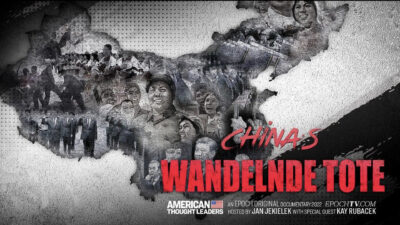
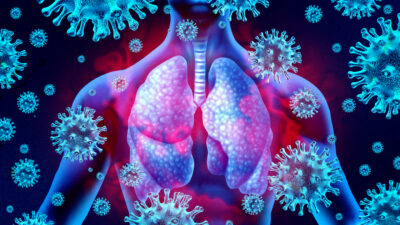




















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion