
„Von Kartoffeln und Kanaken“: Warum Integration im Klassenzimmer scheitert

„Lehrer sind in erster Linie dem Grundgesetz verpflichtet und nicht falsch verstandener Toleranz.“ Diesen Satz könnte man als Grundidee formulieren für ein Buch, dass in wenigen Tagen im deutschen Buchhandel erhältlich sein wird.
Geschrieben wurde es von der Lehrerin Julia Wöllenstein, die tief in die Kiste ihres Erfahrungsschatzes an einer Gesamtschule in Kassel greift, um die Probleme, die eine verstärkte Zuwanderung aus fremden Kulturkreisen nach Deutschland vor allem auch an den Schulen mit sich bringt, nicht nur benennt, sondern auch Lösungsvorschläge aufzeigt.
Wie sie einführend schreibt, gleiche ihr tägliches Berufsleben manchmal einem „unmöglichen Spagat“, nämlich dann, wenn sie versuche, ihre persönliche Haltung in ihre tägliche Arbeit einzubringen und dennoch professionelle Distanz wahren will.
Die Mehrzahl ihrer Schüler hat einen Migrationshintergrund, was nicht nur aufgrund der oft nur rudimentären Deutschkenntnisse zu Problemen führt. Unterschiedliche kulturelle und religiöse Hintergründe führen zu Konflikten untereinander, die einen Lehrer vor Aufgaben und Herausforderungen stellen, die weit über das normale Unterrichten hinausgehen. Dass Integration in der Schule funktionieren könne und müsse, das ist ihr Credo.
In ihrem Buch „Von Kartoffeln und Kanaken“ (ET 17.4.) zeigt sie, wie Kinder mit unterschiedlicher Herkunft und Begabung besser miteinander lernen können. Gleichzeitig gibt sie einen Ausblick auf eine Schule, wie sie einmal sein müsse – mit klaren Regeln und einer gelungenen Integration.
Julia Wöllenstein möchte ihren Schülern ein demokratisches und emanzipiertes Vorbild sein, das sich mit ihrer Lebenswelt auseinandersetzt. Jemand, der ihre Fragen beantwortet und ihre Unsicherheiten mit ihnen diskutiert, damit sie lernen, eigenständig zu denken und Dinge zu hinterfragen. Ohne dies würden die Kinder ihrer Meinung nach womöglich nie die Chance bekommen, den Platz in der Mitte unserer Gesellschaft zu finden, der ihnen zusteht. Auch sei eine klare Haltung gegenüber unserer Kultur, unseren Werten und auch unserem Verständnis von Religion und Glauben Voraussetzung, sich in diesem Land zu integrieren, betont Wöllenstein.
An ihrer Schule lernen Kinder aus etwa 56 Nationen und die bräuchten klare Regeln und auch Grenzen, um einen vernünftigen Schulalltag gewährleisten zu können, schreibt die Lehrerin.
„Er hat meine Mutter beleidigt. Da hab ich ihn geschlagen“
Eindrucksvoll schildert Wöllenstein an Beispielen aus ihrem Schulalltag, wie die komplett unterschiedlichen Kulturen in der Schule oft aufeinanderprallen und welches gegensätzliche und zugleich für die jeweilige Kultur typische Verhalten den Ausgang von Konfliktsituationen prägt. So schreibt sie über eine Konfliktsituation auf dem Fußballfeld, bei der die Kinder mit muslimischem Hintergrund ihre Ehre durch eine Schlägerei wiederherstellen wollen und dabei diejenigen Kinder, die sich nicht provozieren lassen, als Feiglinge bezeichnen. Sie schreibt:
Hier geht es um den Unterschied kultureller Strukturen zwischen patriarchal und liberal organisierten Familien. Natürlich soll hier nicht verallgemeinert werden. Nicht alle Familien mit Migrationshintergrund leben patriarchale Strukturen und nicht in allen deutschen Familien herrscht Demokratie und Gleichberechtigung. Dennoch vollziehen Kinder aus patriarchal strukturierten Familien, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund, in den ersten Lebensjahren Lern- und Entwicklungsprozesse, die für ein Leben in einer demokratischen Gesellschaft hinderlich sein können. Kinder aus diesen Familien nehmen sich nicht als Individuen mit eigenem Willen wahr, da die traditionell patriarchale Familie den Vater als alleiniges Familienoberhaupt manifestiert. Das Kind lernt eine Art von Respekt, den der Psychologe und Autor Ahmad Mansour als „Unterwerfung“ beschreibt und der notfalls mit Gewalt oder Strafen erzwungen wird. Bei Kindern aus patriarchalen muslimischen Familien kommt allerdings noch eine kulturelle Komponente hinzu. Sie erleben sich immer als Teil einer Gemeinschaft, der Umma. Die Umma bezeichnet im Bereich des Islam eine Gemeinschaft, die ähnlich wie ein Volk oder eine Nation über den Rahmen eines Stammes oder Clans hinausreicht. Im engeren Sinne wird der Begriff für die religiös fundierte Gemeinschaft der Muslime verwendet. Ihre Interessen stehen über denen des Individuums. Dies führt nicht nur dazu, dass jedes einzelne Familienmitglied dazu verpflichtet ist, die Ehre des Clans zu verteidigen, sondern auch dazu, dass jeder auch für den anderen einsteht. Das erlebe ich auch in den Cliquen, die meine Schüler bilden. Hat einer ein Problem, fühlen sich alle angesprochen und mischen mit. Was wiederum erklärt, warum es zu Situationen wie der auf dem Fußballplatz kommt, in der ein Junge sich provoziert fühlt und alle anderen in den Streit mit einsteigen. Diese Situation steht hier stellvertretend für das, was wir als Lehrer täglich in den Pausen erleben, wenn ein Streit eskaliert und sich sofort riesige Gruppen bilden, die aufeinander losgehen. Kinder, die in aufgeklärten, liberalen Elternhäusern groß werden, und das können auch Familien sein, deren kulturelle Wurzeln nicht in Deutschland sind, entwickeln eine gegensätzliche Grundhaltung. Das Individuum und der persönliche Wille stehen an erster Stelle. Der eigene Wille und die Fähigkeit, verschiedene Meinungen zu diskutieren, werden gefördert und sind, oftmals sogar zum Leidwesen der Eltern, erwünscht. Dass auch diese Entwicklung in ihrer reinsten Form bedenklich ist, zeigen Bücher wie Jesper Juuls „Nein aus Liebe“, in dem deutlich wird, dass auch Eltern Grenzen setzen dürfen und müssen, um sich nicht aus falsch verstandener Bedürfnisorientierung zu den Bediensteten ihrer eigenen Kinder zu machen. Es muss also nicht immer und alles ausdiskutiert werden, es geht allerdings grundsätzlich um die Frage, wie wir angemessen Grenzen setzen. Mir ist es wichtig, dass hier deutlich wird, dass jede Erziehungsform in extremer Ausprägung auch ihre Schattenseiten hat und es keinesfalls nur in extrem patriarchal strukturierten Elternhäusern zu Problemen kommt.
Um solche Probleme zu bewältigen, bräuchten die Lehrer Zeit und Raum, erklärt Wöllenstein. Als Beispiel für den Lernprozess in diesen konkreten Fall führt sie das „Konflikt-Theater“ an, wobei zwei Schüler einen typischen Streit vorspielen. Zudem gibt Wöllenstein weitere Tipps an Lehrer, mit welchen Methoden hier vorgegangen werden kann. Hierbei zeigt sich, dass die Autorin nicht nur Lehrerin ist, sondern zuvor schon acht Jahre lang als Kinder- und Jugendbetreuerin gearbeitet hat. Ihr Wissen stellt sie hier für den Leser – und Lehrer – zur Verfügung, denn, wie sie schreibt weiß sie, dass „von Lehrern im heutigen Schulalltag oft abverlangt wird, Sozialarbeiter, Therapeut und Religionsexperte gleichzeitig zu sein.“
In weiteren Kapiteln ihres Buches geht es um Themen, wie: Grundgesetz, Ramadan, das Kopftuch, Parallelwelten – und warum wir sie verstehen müssen, aber nicht akzeptieren dürfen, um gelungene Sprachintegration, Chancen ästhetischer Bildung im Integrationsprozess und den Nahostkonflikt an unseren Schulen.
Im Kapitel, „Wenn Elternarbeit an ihre Grenzen stößt“ wird vor allem das Thema „Beschneidung“ aufgegriffen, hauptsächlich die Beschneidung von jungen Mädchen, auch als Genitalverstümmelung bekannt. Hier sei ein sensibler Umgang mit dem Thema angeraten, damit betroffene Mädchen sich nicht stigmatisiert fühlten. Eingegangen wird dabei auch auf den Sexualkunde-Unterricht in der Schule, der als Sexualerziehung seit 1968 von der Kultusministerkonferenz für den Biologieunterricht vorgesehen und als Aufgabe der Schule formuliert wird.
„Ich kann nicht ’nein‘ zu meinem Sohn sagen. Sehen Sie ihn sich doch an! Er ist so schön!“
Zum ganz besonderen Verhältnis muslimischer Mütter zu ihren Söhnen sei hier noch eine Leseprobe aus dem Kapitel „Wo das Grundgesetz endet“ aufgeführt. Das oben aufgeführte Zitat stamme aus ihrem Schulalltag und sei keineswegs erfunden. Wöllenstein schreibt:
In einer Fortbildung erklärte der Psychologe Ahmad Mansour, warum muslimische Jungen öfter als Mädchen das deutsche Schulsystem ohne Schulabschluss verlassen. Das liege häufig daran, dass ein Sohn in muslimischen Familien von Geburt an der Prinz im Hause sei und dies sei allein der Anwesenheit seines primären Geschlechtsteils geschuldet. Dem Sohn wird von Anfang an die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Mutter gewidmet, „denn sie ist ihrem Sohn von Geburt an dankbar, weil er ihren Stellenwert im sozialen Gefüge erhöht“. Als Stammhalter der Familie steigert er das Ansehen der Mutter in der Gemeinschaft. Somit liest sie ihm von Geburt an jeden Wunsch von den Augen ab. Doch nicht nur die Mutter ist dazu da, dem Sohn das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Sollte er Schwestern haben, gilt das natürlich auch für sie, die von frühester Kindheit an lernen, dass es ihre Aufgabe ist, dem Bruder – und natürlich auch dem Vater – zu Diensten zu sein. Dieses in Fachkreisen „Söhnchenkult“ genannte Verhätscheln der Söhne von frühester Kindheit an führt dazu, dass muslimische Jungen, die so aufwachsen, das Gefühl haben, allein ihre bloße Anwesenheit reiche aus, um im Leben erfolgreich zu sein. Kommen diese Kinder aber nun in die Schule, die leistungsorientiert bewertet, gerät ihre Selbstwahrnehmung ins Wanken. Auf einmal reicht es nicht mehr aus, ein Junge zu sein. Man muss Leistung erbringen, Regeln befolgen und sich, was für viele Jungen besonders schwer ist, im Klassenzimmer durch angemessenes Verhalten und Wissen in gleichberechtigter Konkurrenz zu den Mädchen behaupten. Hier entstehen dann bizarre Situationen, wenn das Wertegerüst der Jungen ins Wanken gerät. Sie benehmen sich dann oftmals wie kleine Paschas, ohne dass ihnen das wirklich auffällt, denn sie finden das ja normal, dass die Mädchen ihnen alles abnehmen. Sie kennen es nicht anders. Mal weigert sich dann ein Schüler, den Klassenraum zu fegen, weil er doch ein Junge sei. Ein anderes Mal setzt sich die Mutter mit in den Unterricht, weil sie es nicht glauben kann, dass ihr perfekter Sohn in der Schule während des Unterrichts aufsteht, schwätzt, nicht auf die Lehrerin hört und seine Aufgaben nicht bearbeitet…
Sieben Forderungen an Politik und Gesellschaft
Am Ende des Buches stellt die Autorin sieben Forderungen an Politik und Gesellschaft in den Raum, die für eine bessere Integration und ein besseres Miteinander unabdingbar seien.
Mit ihrem Buch will sie sich vor allem „aktiv für bessere und gerechtere Bildung stark machen und in diesem Zuge auf Missstände aufmerksam machen, damit Lösungen gefunden werden können“, schreibt sie abschließend. Sie sei gerne und mit großer Leidenschaft Lehrerin und überzeugt davon, dass die staatliche Schulbildung eine großartige Einrichtung sei.
Und doch habe sie schon immer einem Wandel unterlegen, der mit der sich verändernden Gesellschaft zusammenhängt. Wenn das Fachpersonal aber seine Expertise nicht in diesen Prozess einbringen könne, würden die Veränderungen, die aufgrund der aktuellen Bildungssituation notwendig sind, mit großer Wahrscheinlichkeit an den Bedürfnissen vieler Schüler vorbeigehen, so Wöllenstein, und das könne weder den Lehrern noch der Gemeinschaft egal sein, denn man brauche die Kinder als zukünftige Stützen der Gesellschaft.
Julia Wöllenstein: Von Kartoffeln und Kanaken
Warum Integration im Klassenzimmer scheitert. Eine Lehrerin stellt klare Forderungen
mvg Verlag, Softcover, 192 Seiten
ISBN: 978-3-7474-0055-5
14,99 Euro (D) bzw. 15,50 Euro (A)






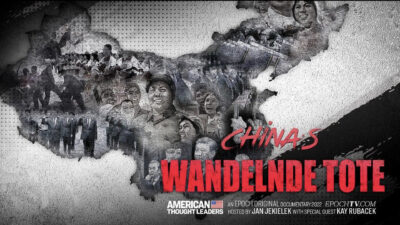






















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion