
Familie und die Freiheit

Mit der Flucht aus dem kommunistischen Rumänien riskierte der damals 30-jährige Tiberiu Czentye sein Leben in der Hoffnung, eine bessere Zukunft für seine Kinder zu finden. Jahrzehnte später erzählt er seine Geschichte und hofft, dass sie dazu beitragen wird, die erneut um sich greifende Strömung des Sozialismus aufzuhalten.
Der schwerste Moment für Tiberiu Czentye war damals der Abschied von seiner Frau und seinen beiden Söhnen – schwieriger als der bevorstehende 60 Kilometer lange Marsch, der damit endete, dass er auf dem Boden kriechend versuchte, bewaffneten Wachen nahe der rumänisch-jugoslawischen Grenze zu entkommen. Ja, sogar schwerer als die monatelange Zwangsarbeit in einem jugoslawischen Gefängnis, nachdem er doch gefangen genommen worden war. Und härter als die zwei Jahre, die er entweder als Gefangener oder als Flüchtling verbrachte, während er fünf Länder durchquerte, bevor er schließlich seine Freiheit gewann. „Ich bin aus Rumänien geflohen, um die Zukunft meiner Kinder zu sichern“, sagt Czentye. „Es war mit Abstand der schwierigste und schmerzhafteste Moment meines Lebens, als ich das Licht ausschaltete und meine Kinder und meine Frau zum Abschied küsste, weil ich nicht wusste, ob ich sie jemals wiedersehen würde.“
Czentye und seine Familie lebten im kommunistischen Rumänien während des Regimes von Nicolae Ceausescu. Von Anfang an war er sich über sein Ziel im Klaren: Er wollte nach Amerika. Dort würden seine Familie und kommende Generationen die Chance auf eine bessere Zukunft und ein Leben in Freiheit haben. „Ich habe sie hierhergebracht, damit sie eine Zukunft haben, sich gut fühlen und in Sicherheit leben können. Es gab sehr gute Gründe dafür, mein Leben zu riskieren“, sagt er.
Der Wert der Menschenwürde
Als Czentye sich auf die Flucht begab, waren die Lebensumstände unter der Herrschaft der Kommunistischen Partei im sozialistischen Rumänien von 1989 trostlos. Schulen waren Zentren der Gehirnwäsche, Fleiß wurde bestraft und die Zukunftsaussichten seiner Söhne waren noch schlechter als seine eigenen. Aber die Rumänen setzten den Sozialismus nicht immer mit einer Diktatur gleich – viele Menschen auf der Welt tun dies bis heute nicht. Anfangs wurden kostenlose Dinge versprochen, wodurch der Sozialismus Fuß fassen konnte, so berichtet Czentye.
Sobald die Kommunistische Partei jedoch an der Macht war, wurde schnell klar, dass sie ihre Versprechen nicht einhalten konnte. Das Regime schloss die Grenzen, verwandelte sich in eine Diktatur und seine unrealistischen Ziele führten schließlich zur Verarmung des Landes: „Unter diesen Restriktionen und politischen Maßnahmen kam es zu einem Mangel an Lebensmitteln, einem Gasmangel – fast alles wurde zur Mangelware“, so Czentye. „Die Menschen waren am Sterben.“

Die Czentyes in San Francisco im Jahr 1991.
Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Tiberiu Czentye
Was ihm besonders naheging, war die Erkrankung seines jüngeren Sohnes. Im Krankenhaus erfuhr Czentye von einer Behandlungsmöglichkeit, die seinem Sohn helfen konnte. Das Medikament wurde jedoch außerhalb Rumäniens hergestellt und das Regime weigerte sich, ausländische Arzneimittel zu importieren. Bestürzt über diese Zustände holte Czentye seinen Sohn aus dem Krankenhaus ab, stellte eine Krankenschwester ein und kaufte das Medikament auf dem Schwarzmarkt. So konnte sein Sohn wieder gesund werden.
So viel Unternehmergeist stand eindeutig auf Kriegsfuß mit der sozialistischen Kultur.
Die Menschen in Rumänien hätten drei Möglichkeiten gehabt: Sie konnten hart arbeiten und ihr Bestes geben, durften sich aber weder profilieren noch die Früchte ihrer Arbeit sehen. Oder sie konnten faul werden und den gleichen Lohn wie alle anderen kassieren. Die dritte Möglichkeit war, auszusteigen.
Problematisch war auch das kommunistische Bildungssystem. Vom Kindergarten bis zur Universität konzentrierte man sich dort auf die Gehirnwäsche der jungen Menschen und die Verherrlichung der Kommunistischen Partei, erklärt Czentye.
Die Geschichte wurde umgeschrieben, alle Medien waren staatlich gelenkt, Privateigentum verschwand und die Bewegungsfreiheit wurde überwacht und stark eingeschränkt.
Damit das Regime seine Täuschung aufrechterhalten kann, bedarf es ständiger Lügen und Gehirnwäsche. In einem Land, in dem niemand die Partei kritisieren darf, macht die Geheimpolizei Nachbarn zu Informanten. „Wenn irgendwer, vielleicht nur ein einziger Nachbar, dir zusteckt: ‚Nun, Tibi hat das gesagt…‘, dann brechen sie morgens die Tür auf, nehmen dich mit und du verschwindest für immer“, berichtet er.
„Die Menschen halten nicht mehr zu dir. Alle wertvollen menschlichen Qualitäten gehen verloren. Es ist nicht ganz fair, das so deutlich auszusprechen – aber sie werden so wie Tiere, die sich einfach der Macht beugen!“
Für Czentye lag das Gegengewicht darin, dass er tief verwurzelt war in seinen familiären Werten. Als er aufwuchs, erlebte er den Zusammenhalt seiner Großeltern und seiner Eltern. Daher wollte er nicht nur ein schöneres Leben für sich selbst: Er wollte eine Zukunft, in der sich seine Söhne entfalten konnten.
„Deshalb habe ich mein Zuhause verlassen, und zwar allein. Die Grenze war mit Waffengewalt abgeriegelt, sie haben Leute erschossen – denn sie lassen einen nicht einfach gehen. Ich dachte: ‚Wenn, dann bitte tötet mich, aber nicht meine Familie.‘“
In den Niederlanden beantragte Czentye politisches Asyl für die Vereinigten Staaten und ersuchte Rumänien um die Erlaubnis für seine Familie, ihn zu besuchen. Der Zeitpunkt war günstig. Das Regime war gestürzt worden, und eine neue Regierung bemühte sich um ihre Legitimierung. So wurde Czentyes Antrag stattgegeben.
Es sollte noch zwei weitere Jahre dauern, bis Czentyes Asylantrag stattgegeben wurde und er 1991 in die Vereinigten Staaten gehen konnte.
„Ich hatte zwei Gepäckstücke, zwei Kinder, meine Frau und Gott“, sagte Czentye. Er landete in Portland, Maine, wo seine Familie ein Jahr lang Anspruch auf staatliche Unterstützung hatte. Nach nur drei Wochen lehnte er dieses Angebot ab. Die Familie packte stattdessen ihre Sachen und stieg in einen Bus, der sie quer durch das Land brachte. Ihr Ziel war San Francisco, eine Wirtschaftsmetropole mit vielen Möglichkeiten.
Die Zukunft seiner Enkelkinder
In San Francisco hatte Czentye drei Jobs gleichzeitig und nahm fünf Jahre lang weder Urlaub noch Krankentage in Anspruch, bevor er sein eigenes Unternehmen gründete. Aber mittlerweile hat sich die Lage in Kalifornien – und in vielen Teilen Amerikas – stark verändert, sagt er. Czentye ist entsetzt darüber, wie der Sozialismus in den Vereinigten Staaten zu einer populären Bewegung wurde: „Ich fühle mich dazu verpflichtet, diesen Spinnern, die den Sozialismus toll finden, durch meine Geschichte zu zeigen, dass dem nicht so ist“, sagt er.
Czentye räumt ein, dass für diese Hinwendung zum Sozialismus die Schuld nicht ausschließlich nur bei den jungen fehlgeleiteten Menschen zu finden ist. Es liegt auch daran, dass sie von ihren Eltern im Stich gelassen wurden, die ihnen nicht nahegebracht haben, mehr auf den eigenen Charakter zu achten. Möglicherweise hat auch das Bildungssystem versagt, das junge Menschen in teure Ausbildungen für bereits übersättigte Branchen drängt und ihnen Kredite aufbürdet, die sie nur mühsam zurückzahlen können.
Noch bevor Czentye einen Fuß nach Amerika setzte, studierte er die amerikanische Kultur. Vom ersten Tag an waren sich seine Frau und er einig: Die Eltern sind die wichtigsten Lehrer im Leben. Polizei und Lehrer spielen zwar auch eine Rolle, aber sie sollten niemals die elterliche Führung ersetzen. Er sprach offen über den Sozialismus, den Kommunismus, die Geschehnisse in Rumänien und die Torheiten der menschlichen Natur.
Czentye und seine Frau wollten ihren Söhnen ein gutes Leben ermöglichen, sie hatten aber auch klare Erwartungen an sie: Die Jungs sollten die guten Manieren, die ihnen beigebracht wurden, anwenden und sich um gute Leistungen bemühen – und das taten sie auch. Ihre Söhne haben nun ihre eigenen Familien gegründet und erziehen ihre Kinder nach denselben traditionellen Werten.
Ohne gute Werte kann der Charakter eines Menschen leicht abgleiten. Es schleicht sich Faulheit ein und die Geisteshaltung, anderen die Schuld an allem zu geben, bietet einen leichten Ausweg.
Ein Geist voller Vorwürfe findet leicht Gefallen am Sozialismus und seinem Versprechen, dass man hier etwas kostenlos erhält. Davor warnt Czentye.
Ein zweites Alarmzeichen ist die Taktik, die an das erinnert, was er seinerzeit in Rumänien erlebt hat. Es ist die Kultur der Spaltung, die sich in Amerika breitmacht. „Die Sozialisten arbeiten sehr hart daran, uns zu spalten: nach Nationalitäten, nach Arbeitern und Angestellten, nach Parteizugehörigkeit – all diese Dinge“, sagt er.
Czentye vertraut aber darauf, dass sich die Wahrheit durchsetzen wird. Sobald die Menschen den Sozialismus als das erkennen, was er in Wirklichkeit ist, wird Amerika ein freies Land bleiben.
„Seit ich hier bin, hatte ich die Gelegenheit, auch viele andere Länder zu bereisen. Seit ich meine Firma habe, war ich wieder in Europa, Südamerika, China, Afrika und Japan. Amerika ist nicht perfekt, soviel kann ich sagen. Aber hier ist es dennoch am besten“, sagt er. „Von hier werde ich nicht mehr weggehen. Ich werde kämpfen und tun, was ich kann – gegen den Sozialismus und für eine freie Gesellschaft.“





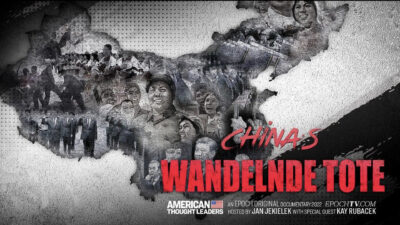






















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion